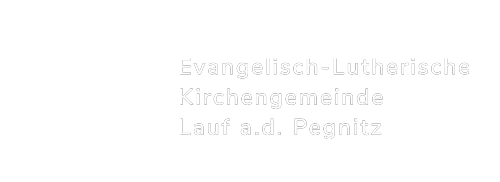Liebe Larissa, du hast ja wirklich unglaublich viel geleistet heute. Und all diese Dinge habt ihr in einem öffentlichen Bus/Straßenbahn transportiert? Vielen Dank auch für deine Predigt. Du hast mich angerührt. Dein Mut, deine Zuversicht und dein Glauben in diesen Zeiten sind bewundernswert. Ich überlege, ob ich nicht deine Predigt morgen im Livestream online in deinem Namen halte. Natürlich auf deutsch – so skizzenhaft die Predigt ist, so eindrücklich ist sie. Authentisch. Und mutmachend. Erlaubst du mir das? Janosch)
Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. (Röm. 5:8)
GEBET DES TAGES
Unser Erlöser, Du siehst, wie hilflos wir angesichts der äußeren Gefahren sind.
Bewahre uns, reinige unsere Herzen von aller Schlechtigkeit und allen Lastern und schütze uns vor der Macht der Finsternis – um Jesu Christi, unseres Herrn, willen.
***
O Gott, barmherziger Vater, wir bitten dich: Erbarme dich der armen Herde, um derentwillen dein geliebter Sohn sich in die Hände der Sünder gab und einen schändlichen Tod am Kreuz erlitt; gib uns die Gnade, dass auch wir nach dem Beispiel deines Sohnes das Leiden geduldig ertragen und dich allezeit durch ihn, deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, preisen und segnen können.
***
Predigt
“Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.”
Liebe Brüder und Schwestern! Jede Predigt beginnt mit den Worten: “…Gnade sei mit euch und Friede…”. Das sind in der Tat gute und wunderbare Wünsche an euch, nicht vom Prediger, sondern von Christus selbst! Er hat uns durch sein heiliges Opfer sowohl den Frieden mit Gott als auch die Gnade Gottes für ein heiliges Leben in Christus gebracht! Ich denke, das sind die beiden wichtigsten Wahrheiten des christlichen Lebens, besonders in der Fastenzeit!
Heute ist der zweite Sonntag der Großen Fastenzeit, den wir mit den Worten des Reminiscere-Sonntagspsalms “REMINiscere” nennen. Psalm 24,6
Die große Fastenzeit ist uns als Vorbereitung auf das Pascha des Herrn gegeben, die glorreiche Auferstehung Christi von den Toten zu unserer Rechtfertigung und ewigen Erlösung. Deshalb ist die Fastenzeit eine Zeit der verstärkten Verkündigung der Leiden des Gottessohnes. Wir gehen den Weg seines Leidens und begleiten ihn bis zum Kreuz. Dabei erkennen wir, dass er bereit ist, unser Kreuz, unseren Schmerz auf sich zu nehmen.
Unsere Fastenzeit der Solidarität mit unserem leidenden Herrn und Meister. Es ist auch eine Zeit der intensiven Reue und des Bedauerns über die Sünden, die wir mit unseren Gedanken, Worten und Taten begehen.
Der reformierte Kirchenvater Martin Luther begann seine weltberühmten und epochalen 95 Thesen mit folgenden Worten: “Wenn unser Herr Jesus Christus sagt: ‘Tut Buße’, dann will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen von unaufhörlicher Buße geprägt ist.
Wir wollen ihm besonders nahe sein. Die Reue betrifft nicht nur unsere Seele, sondern auch unseren Körper, denn der Mensch sündigt sowohl an Leib als auch an Seele. Und wie M. Luther in seinem kurzen Katechismus schrieb, ist die Fastenzeit ein gutes Werk äußerer Frömmigkeit.
Wie unser Gott uns durch den Mund seines Propheten Jesaja sagt: “Das ist die Fastenzeit, die ich gewählt habe: Teile dein Brot mit den Hungrigen…” (Jesaja 58:6a,7a).
Das möchte ich Ihnen auch sagen. Dass selbst ein strenges und opferbereites Fasten vergeblich sein und zu bloßem Hungertod und Heuchelei werden kann, wenn es ohne die gläubige Teilnahme an der Verkündigung des Wortes Gottes in der Kirche und an den heiligen Mysterien des Leibes und Blutes des Sohnes Gottes im Sakrament des Altars geschieht. Möge euer Fasten aufrichtig sein, zur Ehre Gottes in Christus und zum Wohl eures Nächsten, mit dem ihr euer Brot teilt.
Hören Sie sich den Text aus Johannes 14-21 an: “16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 19 Das Gericht aber besteht darin, daß das Licht in die Welt gekommen ist; aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihre Werke böse waren:20 Denn wer Böses tut, der haßt das Licht und wandelt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden, weil sie böse sind:21 Wer aber rechtschaffen handelt, der wandelt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden; denn sie sind in Gott gemacht.
Wir sind manchmal kleinlich, neidisch, böse und ungeduldig, suchen oft das “Eigene”, streben danach, andere unterzuordnen, sind unfähig, wirklich zu lieben und zu opfern…
Wir versuchen vielleicht sogar, Gott uns selbst unterzuordnen … Wir beunruhigen Gott ständig mit unserem “Warum?”, “Wieso?”, “Weshalb?”.
Fastenzeit inmitten des Krieges.
Man kann sich kaum etwas Unvereinbareres vorstellen: eine stille Zeit des Gebets und eine Zeit der Kriegsführung.
Tod und Leid brachen in unsere maßvolle Welt ein. Der Krieg mit all seinen Schrecken und Problemen war bereits in die Häuser einiger Menschen eingezogen, für andere stand er vor der Tür. Und in einem Augenblick wurde alles, was uns mit Selbstverständlichkeit beschäftigt hatte, wertlos, in einem Augenblick verschwand unsere gewohnte Stabilität, unsere zufriedene Zuversicht schwand.
Und plötzlich wurde uns klar und deutlich: Alles in unserer Wirklichkeit hängt von Gott ab, von seinem Willen und seiner Gnade. Ich bete rund um die Uhr, für mich, für das Lager, für die Welt und für jeden von euch, für jeden Reisenden. der jeden Tag vor meinen Augen vorbeizieht. Ich bete. Für diejenigen, die Hilfe leisten, für diejenigen, die Hilfe leisten und sie erhalten. Und ich bete.
Außer dem Herrn gibt es nichts und niemanden, auf den man hoffen kann, alles ist in seiner rechten Hand!
Wie lange beten wir schon so, wie wir jetzt beten?
Wie lange haben wir uns schon so nach der Beichte gesehnt wie jetzt? Seit wann schätzen wir jede Gelegenheit, in die Gemeinschaft zu kommen, so sehr, wie wir es jetzt tun?
Heute wird uns mehr denn je bewusst, wie nahe uns der Herr ist und wie unbedeutend wir vor ihm sind. Er LIEBT uns! Er ist geduldig mit uns! Er vergibt uns unendlich oft! Er hört uns immer – und hört zu! Er liebt uns so sehr, dass er seinen unschuldigen Sohn für uns, die Grausamen und Stolzen, hergab, damit wir zerrissen werden! Damit wir durch ihn das ewige Leben haben! Dass wir in ihm, in Christus, mit ganzer Seele und ganzem Herzen nach Licht streben! Dass es keine Dunkelheit in unseren Seelen geben soll!
In der Tat, wie viel Dunkelheit gibt es in der Welt, in der Gesellschaft, in deinem Herzen… Wie viel Gleichgültigkeit und sogar Wut ist in deinem Herzen … Wir alle, wir alle brauchen Gottes Vergebung und Christi Liebe…
Überall herrscht Aufruhr.
Aber wer wüsste besser als wir Gläubigen, dass niemand jemandem ein Morgen versprochen hat. Nicht vorher und nicht jetzt. Weder im Krieg noch im Frieden.
Seit dem Sündenfall bis heute ist die einzige Zeit, die dem Menschen zur Verfügung steht, das Heute, oder besser gesagt, der gegenwärtige Augenblick dieses Tages.
Hat der Krieg etwas verändert? Nein. Aber es hat sich etwas anderes geändert.
Neben uns ist ein leidender Nachbar. Die Mittellosen, die Einsamen, die Alten, die Flüchtlinge, die Mittellosen, die Krieger und die Friedfertigen. Und sie alle haben uns Christen. Wir können helfen, wir müssen helfen, viele Schwestern und Brüder spenden uns jetzt, so wirkt der Herr, durch unseren Nächsten.
Dies ist unsere Verantwortung, unser Heilmittel gegen Angst, Feigheit, Gier und Egoismus.
Jeder Nachbar ist unser Gewissen. Wir müssen uns den Prüfungen mutig stellen. Wenn Menschen massenhaft in Angst, Panik, Verzweiflung und Hass verfallen, ist es unsere Berufung, für sie da zu sein. Den Glauben, die Hoffnung und die Liebe zu teilen.
Denn wenn man sich jetzt nicht auf uns Christen verlassen kann, auf wen dann?
Gott ist mit uns!
Gott beschützt uns!
Gott gibt uns eine Zukunft!
Der Sieg über das Böse und der Triumph des Friedens, der Würde und der Freiheit!
GEBET Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, für dein heilbringendes Wort, durch das du uns aufbaust und lehrst, unseren Glauben stärkst und reinigst und unser Leben täglich erneuerst, und wir beten zu dir: Gib uns die Gnade und die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir im Glauben nach deinem Wort die wahre Frucht der unbarmherzigen Reue hervorbringen, zu der du uns in deiner Güte führst, und dir im Glauben und in der Gerechtigkeit dienen und unserem Nächsten in der Liebe nach dem Glauben. Bei Jesus Christus, unserem Herrn. AMEN
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, sei in unseren Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN
«Второе воскресенье великого поста — Reminiscere».
Рим 5: 1 — 11 НЗ. Ин 3: 16 — 21. ВЗ. Исаия 5:1-7
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. (Рим. 5.8)
МОЛИТВА ДНЯ
Избавитель наш, Ты видишь, как мы беззащитны перед лицом опасностей, угрожающих нам извне.
Сохрани нас, очисти наши сердца от всякого нечестия и порока и защити нас от власти тьмы – ради Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Боже, Отче милосердый, молим Тебя: милостиво призри на бедное стадо, ради которого возлюбленный Сын Твой предал Себя в руки грешников и претерпел позорною крестную смерть; дай нам благодать, чтобы по примеру Сына Твоего и мы терпеливо переносили страдания и во всякое время славили и благословляли Тебя через Него же Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа нашего.
«Благодать вам и мир, от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
Дорогие братья и сестры! Каждая проповедь начинается со слов: «…Благодать вам и мир…». Это действительно, хорошие и замечательные пожелания вам, не от проповедующего, а от Самого Христа! Он, своей Святой Жертвой принес нам и мир с Богом, и благодать от Господа для Святой жизни во Христе! Думаю, это две самые важные истины Христианской жизни, особенно во время Великого Поста!
Ныне уже Второе Воскресенье Великого Поста, которое мы называем словами Псалма дня Воскресенья Reminiscere «ВСПОМНИ». Пс.24:6 Великий Пост нам дан, как время нашего приготовления к Пасхе Господней, Светлому Христову воскресенью из мёртвых ради нашего оправдания и вечного спасения. Именно поэтому время Поста – это время усиленной проповеди страданий Сына Божьего. Мы проходим путь страданий ИХ, сопровождаем Его на крест. При этом мы понимаем, что Он готов взять на себя наш крест, нашу боль. Наш Пост солидарности с нашим страдающим Господом и Учителем. Это ещё и время усиленного покаяния и раскаяния в своих грехах, которые мы совершаем нашими мыслями, словами и делами. Отец – реформатор Церкви Мартин Лютер начал свои всемирно известные и эпохальные 95 тезисов такими словами: «Если наш Господь Иисус Христос говорит: «Покайтесь!», то Он желает, чтобы вся жизнь Его верных была непрестанным покаянием». Мы хотим быть особенно близко к Нему , покаяние касается не только нашей души, но и нашего тела, потому что человек грешит и телом и душой. И ещё М. Лютер писал в своём Кратком Катехизисе, ПОСТ – это хорошее дело внешнего благочестия». Как нам говорит наш Бог устами Своего пророка Исаии: « Вот пост, который Я избрал: …раздели с голодным хлеб твой…»( ис.58: 6а.7а)
Ещёхочу вам сказать. Что даже суровый и жертвенный пост может стать напрасным и превратиться в простое голодание и лицемерие, если он совершается без участия верою в церковной проповеди Божьего Слова и участия в пресвятых тайнах Тела и Крови Божьего Сына в Таинстве Алтаря. Пусть будет ваш пост искренним, во славу Божью во Христе и во благо вашего ближнего, с которым вы разделите свой хлеб.
Послушайте текст Евангелия от Иоанна 14-21 «16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. 18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 19 Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны»
Мы порой мелочны, завистливы, злы и нетерпеливы, часто ищем «своего», стремимся подчинять себе других, не умеем по настоящему любить и жертвовать… Мы и Бога стремимся себе порой подчинить… Постоянно тревожим Бога своим «а почему?», «а зачем?», «а за что?».
Великий пост в условиях войны.
Сложно представить, более несовместимые вещи: тихое время молитвы и боевые действия.
Смерть и страдания ворвались в наш размеренный мир. Война, со всеми ужасами и бедами, к одним уже пришедшая в дом, а у других стоящая на пороге. И в одно мгновение обесценилось все то, что занимало нас безраздельно, вмиг исчезла привычная стабильность, улетучилась сытая уверенность.
И нам вдруг стало ясно и очевидно: в нашей реальности всё зависит от Бога, от Его воли и милости. Я молюсь 24/7.За себя, за стану, за весь мир и за каждого из вас, за каждого путника. Который проходит перед моим взором каждый день. Я молюсь. За тех кто оказывает помощь, за тех кто её осуществляет и получает. А молюсь.
Кроме Господа не на что и не на кого надеяться, всё в Его деснице!
Давно ли мы молились, как молимся сейчас?
Давно ли мы так жаждали исповеди, как теперь? Давно ли так ценили каждую возможность прийти в общину, как нынче?
Сейчас, как никогда, ощущается, насколько близок к нам Господь, и насколько ничтожны перед Ним мы. Он нас — ЛЮБИТ! Он нас — ТЕРПИТ! Он нас бесконечно — ПРОЩАЕТ! Он нас всегда — СЛЫШИТ и СЛУШАЕТ! Любит до такой степени, что отдал своего невинного Сына нам, жестоким и гордым, на растерзание! Чтобы мы имели через Него вечную жизнь! Что бы мы в нем, во Христе, стремились всей душою и сердцем к свету! Чтобы в нашей душе не было тьмы!
Действительно, сколько сейчас тьмы в мире, в обществе, в твоем сердце… Сколько равнодушия и даже злобы в твоей душе… Всем, всем нам так нужно прощение Бога и любовь Христа…
Вокруг неспокойно.
Но, кому как не нам, верующим, знать, что завтрашнего дня никто никому не обещал. Ни раньше, ни сейчас.
Ни в войну, ни в мирную пору.
От грехопадения доныне, единственным временем, находящимся в распоряжении человека, есть исключительно день сегодняшний, а вернее – настоящий миг этого дня.
Разве война что-то изменила? Нет. Но она изменила другое.
Рядом с нами – страдающий ближний.
Немощные, одинокие, старики, беженцы, нуждающиеся, воины и мирные.
И у всех у них есть мы – христиане. Мы можем помочь, мы должны помогать, нам сейчас много сестёр и братьев жертвуют, чтобы мы помогали, так действует Господь, через ближнего.
Это – наша ответственность, наше лекарство от страха, малодушия, жадности, эгоизма.
Каждый ближний – это наша совесть…
От нас требуется встретить испытания с мужеством.
Когда люди массово поддаются страху, панике, отчаянию, ненависти – наше призвание быть рядом.
Делиться верой, надеждой, любовью.
Ведь если на нас, христиан, нельзя будет опереться сейчас, то на кого же тогда?
Бог с нами!
Бог хранит нас!
Бог дарует нам будущее!
Победу над злом и торжество мира, достоинство и свободу!
ПОМОЛИМСЯ Благодарим Тебя, всемогущий Боже и Отче, за спасительное слово Твоё, которым Ты назидаешь и научаешь нас, укрепляешь и очищаешь нашу веру и ежедневно обновляешь нашу жизнь, и молим Тебя: подай нам благодать и Силу Твоего Святого Духа, чтобы принесли мы в вере по Слову Твоему истинный плод нелицемерного покаяния, к которому Ты ведёшь нас в Своей Благости, и послужили Тебе верою и правдою, а нашему ближнему в любви по вере. Иисусом Христом и Господом нашим. АМИНЬ
И мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдёт сердца и помышления наши во Христе Иисусе, Господе нашем. АМИНЬ.
Geschrieben am
11. März 2022