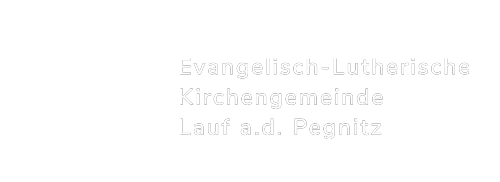Erneute Stellenanzeige: Sekretär (w/m/d) in Teilzeit (20h) für unser Pfarramt in Lauf

Wir sind eine große Kirchengemeinde mit ca. 7000 Mitgliedern, 100 Angestellten und 5 Hauptamtlichen. Unser Pfarramtsteam mit 3 Angestellten am Marktplatz ist Anlaufstelle sowohl für Mitglieder als auch Hilfesuchende und koordiniert sämtliche Aufgaben der Kirchengemeinde einschließlich der evang. Kindertagesstätten.
Wir suchen schnellstmöglich eine tatkräftige und kontaktfreudige Person (m/w/d) für unser Pfarramtsteam, die mit ihrer evangelischen Kirchengemeinde verbunden ist. Arbeitszeit von 20 Wochenstunden ist möglich an vier bis fünf Vormittagen. Qualifizierte schrittweise Einarbeitung wird gewährleistet.
Die Aufgaben umfassen alle Tätigkeiten im Kassenwesen, Bürokommunikation, Registratur, Schrift- und Parteiverkehr.
Wir wünschen uns:
- Soziale Kompetenz und selbständiges Arbeiten, Engagement und Verantwortungsbewusstsein, Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Organisationstalent im Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen in einem großen Team
- Fortgeschrittene Kenntnisse bei aktuellen Office-Anwendungen sowie Flexibilität in der Aneignung kirchlicher Programme
- Nähe zur Kirchengemeinde und Ortskenntnis
Wir bieten:
- Ein sinnstiftendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
- Eine unbefristete Stelle
- Ein freundliches und engagiertes Team
- optimale Rahmenbedingungen für Ihren Dienst
- Großes innerkirchliches Weiter- und Fortbildungsangebot
- Attraktive Vergütung angelehnt an Öffentlichen Dienst nach TV-L, E6 der ELKB mit allen sozialen Leistungen, KVZK Betriebsrente , Radleasing und Sonderzuwendungen.
- Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Beihilfeversicherung, Fahrradleasing
- Urlaubsanspruch von 30 Tagen,
Heilig Abend, Sylvester und Buß-und Bettag gelten als dienstfreie Tage - Förderung von Fort- und Weiterbildung
Weitere Informationen und Bewerbung bis zum 28.4.2025 bitte per PDF an das Evang. Luth. Pfarramt Lauf an der Pegnitz, Kirchenplatz 11, 91207 Lauf an der Pegnitz, zu Händen geschäftsführenden Pfarrer Jan-Peter Hanstein 0151-59206714 .
Familienhaus sucht Büroassistenz
Büroassistenz (m/w/d) I Teilzeit mit 12 Std/Woche I zum 01.06.2025

Lektorenkurs
07.+15.+22.05.22 | jew. 20-22 Uhr | Christuskirche

Geben Sie Gott eine Stimme: „Die Lesung biblischer Texte im Gottesdienst“
In diesem Kurs geht es deshalb darum, eine Theorie des liturgisch-gottesdienstlichen Lesens zu lernen und zu üben. Die Betonung liegt auf Training (Üben), deshalb auch drei Abende. Diese bauen aufeinander auf und so erwarten wir, dass Sie verbindlich auch an allen drei Abenden teilnehmen. Bitte suchen Sie sich für den ersten Abend einen nicht zu langen biblischen Text aus, den Sie vortragen werden und der sie durch die drei Abende begleitet (bitte nur in der Übersetzung von Martin Luther in der Version von 2017).
Was erwartet Sie?
-Übungen und Theorie für Atem, Stimme und Körper (Wie setze ich meine Stimme stimmschonend aber effektiv ein in Verbindung mit guter Atemtechnik.)
-Theorie zur Lesung von biblischen und anderen Texten (Wie lesen, wie vorbereiten)
-Übungen am Lesepult (Wie spreche ich in ein Mikro? Unterschiede der Mikrophone usw.)
-Zeit für Rückfragen und Gespräch.
Sie können an dem Kurs teilnehmen, auch wenn Sie erstmals nur Interesse an dem Thema haben und noch nicht beabsichtigen, zukünftig als Lektorin oder Lektor in der Kirchengemeinde ehrenamtlich zu arbeiten. Da sind sie ganz frei. Die Teilnahme verpflichtet sie zu keiner weiteren ehrenamtlichen Arbeit. Wenn Sie sich also gern mit Texten und deren Präsentation beschäftigen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen. Der Kurs wurde erfolgreich schon in mehreren Kirchengemeinden durchgeführt.
Die drei Termine sind alle im Mai am
Mi 07.05.25
Do 15.05.25
Do 22.05.25 jeweils von 20.00-22.00 Uhr.
Die Veranstaltungsorte sind das Gemeindehaus Christuskirche und die Christuskirche in Lauf (Martin-Luther-Straße 15).
Referenten sind Pfarrer Thomas Reuß und Dagmar Brandt (Gesangspädagogin mit stimmtherapeutischer Weiterbildung).
Bitte melden Sie sich zu diesem Kurs verbindlich an per Mail, Telefon (mit der Angabe von: Name, Adresse, Mail (!), Telefon) bei:
80 Jahre Frieden
Donnerstag, 08.05.2025 | 19.00 Uhr | Johanniskirche
Ökumenischer Dankgottesdienst am 08.05.2025
80 Jahre in Frieden und Freiheit zu leben – dies ist etwas Besonderes, das wir als Deutsche und in Europa dankbar erleben. Nach dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes wurde am 08. Mai 1945 die Kapitulation unterzeichnet. Europa und Deutschland lag in Trümmern, 60 Millionen Tote waren zu beklagen, kaum eine Familie, die nicht vom Tod naher Angehöriger betroffen war. Trauer, Angst und Verzweiflung herrschten in diesen Tagen, auch in Lauf.

Wir wollen diesen Jahrestag annehmen, um dankbar auf 80 Jahre Frieden und Freiheit und dem Leben in einer Demokratie zurückzublicken und werden dies am 08.05.2025 um 19 Uhr in einem Dankgottesdienst in der Johanniskirche tun.
Herzliche Einladung, an alle, die damals den schrecklichen Krieg noch miterleben mussten.
Herzliche Einladung aber auch an Sie und Dich, die wir in diesem Frieden aufwachsen und leben dürfen.
Donnerstag 08.05.2025, 19 Uhr, Dankgottesdienst für den Frieden, in der Johanniskirche
Feierliches Glockengeläut am 08.05.2025 um 19 Uhr
Am 08.05.1945 kapitulierte das Nazi-Regime und der Krieg in Europa war zu Ende. 60 Millionen Tote, schreckliche Morde und Taten waren das Ergebnis dieses Krieges.
Wir dürfen auf 80 Jahre Frieden und Leben in Freiheit zurückblicken. Dies als Anlass wollen wir einen Dankgottesdienst feiern und es mit einer mächtigen Stimme (bzw. Klang) kundtun:
Um 19 Uhr werden die Glocken der Laufer Gemeinde für 10 Minuten läuten, um hörbar zu machen, dass wir uns als Kirche nie mehr einem Unrechtsregime beugen wollen und klar die Botschaft Gottes über unseren Dächern zu hören sein soll. Herzliche Einladung dem Klang zu lauschen, evtl. ein Vaterunser zu beten oder in den Dankgottesdienst in der Johanniskirche zu kommen.
Muttertagskonzert der Laufer Stadtstreicher
Sonntag, 11.05.2025 | 17.00 Uhr | Johanniskirche

Zu ihrem Jubiläumskonzert laden die Laufer Stadtstreicher der Johanniskantorei Lauf am Sonntag, den 11.05.25 um 17 Uhr unter Leitung von Heidi Braun in die Laufer Johanniskirche ein.
Als Solistin spielt die ehemalige langjährige Konzertmeisterin des Orchesters, Clara Arantes das Violinkonzert in a-Moll op. 53 des böhmischen Romantikers Antonin Dvorak.
Schon ab dem Alter von 9 Jahren wirkte Clara bei den Stadtstreichern mit und wurde nach dem Weggang von Kristina Glücker deren Konzertmeisterin. Die 22-jährige Clara studiert derzeit Violine an der Musikhochschule Weimar bei Prof. Lehmann.
Für das höchst virtuose, wirkungsvolle Werk werden befreundete Bläserinnen und Bläser aus dem Nürnberger Raum das Orchester zum Sinfonieorchester erweitern. Dvoraks Violinkonzert ist inspiriert von slawischen Tänzen und hat eine enorme Emotionalität.
Christine Theuerkauf (Flöte) ist den Stadtstreicher seit vielen Jahren als Flötensolistin und Cellistin eng verbunden. Sie musiziert das Andante C-Dur KV 315 von W. A. Mozart mit dem Orchester. Die edle Schlichtheit dieses Stückes und die wunderschönen Cantilenen der Soloflöte prägen das Werk.
Bekannte Highlights aus dem Bereich der Filmmusik bilden den zweiten Teil des Konzertes und laden zum Träumen und begeisterten Mitgehen ein.
Music from „Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt, für Sinfonieorchester arrangiert von Ted Ricketts, wirkungsvoll und mitreißend (Fog Bound – The Medallion Calls – To The Pirates Cave – The Black Pearl – One last Shot – He´s A Pirate).
Aus „James Bond“ von Monty Norman, arrangiert von Victor Lopez (James Bond Theme – For Your Eyes Only – Goldfinger – Live And Let Die – Nobody Does It Better) monumental, gefühlvoll, rhythmisch packend!
Michaela Aichele am Klavier, Christoph Naucke und Horst Faigle am Schlagzeug sorgen für perfektes Filmmusik-Feeling!
(Heidi Braun)
Johanniskirche Lauf
Sonntag, 11.05.2025, 17 Uhr
Karten an den Abendkassen ab 16.15 Uhr erhältlich.
Eintrittspreise: 15,00 €, Schüler und Studenten 10,00 €
Konzert: Die Meistercelli von Nürnberg
Sonntag, 25.05.2025 I 19.00 Uhr I Johanniskirche
Johanniskirche, Kirchenplatz 1
25.05.2025 um 19:00 (Einlass 18:30 Uhr) Weitere Infos,
auch zu den Eintrittskarten, unter www.meistercelli.de sowie www.facebook.com/Meistercelli
Karten im Vorverkauf: 20,00/18,00 €
Abendkasse: 22,00/20,00

Man kann in der eigenen Stadt schön weit in der Welt herumkommen: ob Spanien, Wien, Argentinien: Musik macht es möglich. Als „Die Meistercelli von Nürnberg“ haben sich acht hochbegabte Cellisten mit internationaler Herkunft und Karriere zusammengefunden. Das Repertoire besteht aus meistens bekannten Werken von kurzer Dauer, wodurch das Interesse des Publikums stets aufrechterhalten wird. Nach den etablierten Ensembles Violoncellos Argentinos in Buenos Aires und 8Celli in Stuttgart gründete Carlos Nozzi, Solocellist der Philharmonie Buenos Aires und letzter Cellist von Astor Piazzolla, 2019 „Die Meistercelli von Nürnberg“ in seiner neuen Wahlheimat Franken. Damit setzte er die Erfolgsserie seiner bisherigen Ensembles mit der einzigartigen Mischung aus Tradition und Erneuerung fort. Seitdem ist das Ensemble vor stets leidenschaftlichem Publikum in u.a. München, Erlangen, Coburg, Ellingen, Hersbruck und natürlich Nürnberg aufgetreten. Diesmal haben die Cellisten auch Geigerin Susanne Hofmann als Gastsolistin dabei – die Krönung zum einmaligen Erlebnis.
SCH-LAU-Gartenabteilung – Rasentraktor
Darf es ein bisschen mehr sein? Ja – kein Problem für unsere SCH-LAU-Gartenabteilung. Neben unseren handgeführten Rasenmähern, können wir größere und entsprechend zugängige Flächen auch mit unserem Rasentraktor mähen.

Unsere Gartenabteilung freuen sich darauf, Ihren Rasen zu mähen. Der Rasentraktor erleichtert uns die Arbeit und spart unseren Kunden bares Geld. Die Mähleistung eines Rasentraktors ist mehr als zweimal so hoch ist, wie bei handgeführten Rasenmähern.
Aber nicht immer ist der Einsatz eines Rasentraktors möglich und sinnvoll. Für kleinere oder schlechter zugängliche Flächen setzen wir unsere zwei handgeführten Benzinrasenmäher oder unseren handgeführten Akku-Rasenmäher ein.
Rasenkannten schneiden wir mit einer unserer drei Motorsensen.
Auch bei weiteren Arbeiten im Garten unterstützen wir Sie gerne. Unkraut entfernen, Hecken schneiden oder Ihre Terrasse oder Gehwegplatten reinigen, sind nur einige Beispiele unserer möglichen Leistungen für Sie.
Rufen Sie uns an 09123 965342 – gerne nehmen wir Ihre Anfragen auf und beantworten Ihre Fragen.
Dankbar sind wir für Menschen, die SCH-LAU e.V. beauftragen oder mit Ihrer Spende unterstützen.
Wenn Sie uns unterstützen können und möchten, geht das einmal über die Spendenmöglichkeit auf der Homepage der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Lauf – bitte hierfür SCH-LAU auswählen.
..oder direkt auf unser Konto IBAN: DE53 7606 1025 0001 3343 52 – Verwendungszweck: “SCH-LAU-Gartenabteilung”
Wir sagen jetzt schon D A N K E ! ! !
Sie erhalten jeweils eine Spendenquittung für Ihre Unterstützung.
2. Fastenpredigt
Thema: “Freiheit”
mit Pfr. Dr. Johannes Wachowski, Johanniskirche Lauf 2025
Predigttext Johannes 6,47-51
Das Predigtwort für den heutigen Sonntag Lätare steht im Johannesevangelium im 6. Kapitel. Es ist der Schluss der Brotrede Jesu. Der Evangelist Johannes schreibt (6,47-51):
Jesus Christus spricht: „47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige Leben. 48 Ich bin das Brot des Lebens. 49 Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. 50 Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. 51 Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch – für das Leben der Welt.“
Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Liebe Gemeinde!
Machen wir Brotzeit.
Der Sonntagmorgen von Lätare ist eine gute Zeit dafür.
Denn das Predigtwort spricht sogar vollmundig von einer himmlischen und ewigen Brotzeit. Jesus sagt in ihm: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.“
Also: Machen wir Brotzeit.
Liebe Schwestern und Brüder!
Als kleiner Junge war die Brotzeit mit meinem Opa ein bisschen Himmel auf Erden.
Brotzeit mit dem Opa Hans war fast eine kleine heilige Zeit.
Mein Opa hatte nur noch wenige Zähne, sodass er das Brot klein einschnitt.
Alles wurde fast in Zen-Manier klein geschnitten, wenn es z.B. Stadtwurst mit Musik gab.
Ich machte mit, meine Opa erzählte Geschichten.
Gemeinsam bereiteten wir eine Brotzeit, die nur mit ihm, nur an diesem Ort, nur in dieser Zeitlichkeit, nur in diesem Arrangement so gut schmeckte.
Das kennt Ihr vielleicht alle, dass es bei der Oma und dem Opa noch einmal anders oder besonders gut schmeckte.
Die einfache Brotzeit bedeutete nicht nur Freiheit gegenüber vielen kindlichen Konsumwelten. Milchschnitten gab es damals zum Beispiel noch nicht.
Das Produkt Kindermilchschnitte wurde erst 1978 auf dem deutschen Markt eingeführt.
Und das Essen schmeckte nach viel mehr: nach Füreinanderdasein, nach Langsamkeit, nach Bleiben, nach Aufmerksamkeit, nach Geschichte, auch Familiengeschichte, nach der Liebe von Großvater- und Großmutter usw.
Ihr merkt schon. Brotzeit ist etwas Wunderbares.
Kein Wunder also, dass Jesus in die Welt des Brotes einkehrt, um seine Bedeutung zu unterstreichen: „51 Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.“
Der Jude Jesus hat die Bedeutung der Speisen und des Speisens bestimmt auch von seiner Bibel gelernt. In den Schriften seins Volks heißt es ja z.B.: Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. (Sprüche 15,17)
Essen ist mehr als die Aufnahme von Nährstoffe.
Das macht das ganze 6. Kapitel des Johannesevangeliums, die sogenannte Brotrede, klar.
Sie kulminiert dann in dem Brot des Heils. Sie kulminiert in unsere heutigen Predigtwort.
Liebe Gemeinde!
Machen wir Brotzeit! Haben wir gesagt. Und wir schon ein gesehen, wie wichtig Orte, Zeiten und Menschen dafür sind.
In Deutschland spielt das Brot eine besondere Rolle.
„Brot gibt es in nahezu jeder Kultur auf der Welt. Die Art und Weise, wie es hergestellt und konsumiert wird, variiert aber erheblich, man denke nur an französisches Baguette, israelisches Pita-Brot, indisches Naan, die mexikanische Tortilla oder Damper, ein Busch-Brot der Aborigines aus Australien.
Allein in Deutschland soll es über 3.200 registrierte Brotsorten geben. 2014 nahm die nationale UNESCO-Kommission die deutsche Brotkultur in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Deutschland auf.
Laut dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks kauften im Jahr 2023 die privaten Haushalte 1.616.000 Tonnen Brot: »Die Käuferreichweite für Brot lag bei 97,6%, das heißt von 1.000 Haushalten in Deutschland kauften 976 im Jahr 2023 mindestens einmal Brot. Dieser Wert ist seit Jahren weitgehend stabil.« (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks)
Brot ist ein Grundnahrungsmittel: Für viele Menschen gehört Brot zur täglichen Ernährung dazu. Das verleiht der Aussage von Jesus, dass er das »Brot des Lebens« sei, eine besondere alltägliche Relevanz und existenzielle Tiefe.“ (Wenig, 164)
Wo also anders als in Deutschland könnte das Ich-bin-Wort Jesu, das Wort „Ich bin das Brot des Lebens“ besser verstanden werden: Im Land des Brotes, könnte man fast sagen.
3200 registrierte Brotsorten gibt es hier. Viel zu Essen.
Liebe Gemeinde!
Wir wollen nur von drei Brotsorten sprechen.
Alle drei sind biblische Erzeugnisse.
Alle drei haben mit der Freiheit zu tun.
Alle drei weisen uns einen Weg in die Freiheit.
Und der Lieddicht stimmt ein, wenn wir nun in das Haus der Bibel einkehren und dichtet schön:
„Er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus dem Tod, er nährt und gibet Speisen zur Zeit der Hungersnot, macht schöne rote Wangen oft bei geringem Mahl; und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual!“
Also, auf ihr lieben Seelen von Lauf. Laßt uns ins Lokal der Bibel einkehren.
Und mit diesem Liedvers „Er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus dem Tod, er nährt und gibet Speisen zur Zeit der Hungersnot, macht schöne rote Wangen oft bei geringem Mahl; und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual!“ sind wir gleich bei der ersten Brotsorte.
Es ist das Brot der Freiheit. Diese Brotsorte geht auf das jüdische Passafest zurück.
Beim Passafest sitzen Jüdinnen und Juden nach der Synagoge im Haus zusammen und feiern den sogenannten Seder, eine Hausliturgie mit allen Sinnen. Im Laufe des Seders wir gelesen und getrunken, gegessen und gesungen, gelacht und gedacht. Und es werden Mazzen, das ungesäuerte Brot gegessen.
Das häusliche Fest wir mit dem Verzehr der ersten Mazza eröffnet. Und es wird gesagt:
Dies ist das Brot des armen Mannes, das unsere Vorfahren im Land Ägypten gegessen haben..“ Diese erste Verkündung konzentriert sich auf die Mazza als Symbol für die Armut, die das jüdische Volk während seiner Sklaverei in Ägypten erlitten hat.
Später in der häuslichen Liturgie heben Judinnen und Juden dann die Mazze wieder auf und sie konzentrieren sich auch auf die Tatsache, dass die Mazze gegessen wurde, als Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Diese Mazze wird dann als Brot der Freiheit gegessen.
Deinen dreifachen Geschmack hat dieses Brot der Freiheit.
Zuerst lehrt es und, dass der Weg in die Freiheit nicht viel Materialität braucht.
Wasser und Mehl. Auf keinen Fall Hefe. Einfach, klar und schnell.
Das Brot der Armut, wird dann zum Brot der Freiheit.
Und ein katholischer Theologe, Tomas Halik, schärft uns ja wieder und wieder ein, dass das Problem der Kirche nicht der Atheismus oder die Ungläubigkeit sind, sondern ein dumpfer Konsumismus und unbändiger Materialismus der westlichen Welt.
Das wussten die Bettelorden, dass wussten viele Theologen, dass sich nur eine arme Kirche erneuern kann. Und vielleicht ist es sogar gut, dass die große Konsum- und Steuerparty, dass die dagobertinische Phase der Kirche, wie das genannt wurde, bald aus ist.
Liebe Gemeinde!
Neben der Gewürzmischung von Armut und Freiheit, lehrt uns das Brot der Freiheit noch etwas. Freiheit ist für uns Gläubige immer etwas Gegebenes, etwas Verdanktes, etwas göttlich Initiiertes.
Gewaltig wird das in der biblischen Exodusgeschichte erzählt: Plagenerzählungen und göttliche Demütigung der Mächtigen, Wegweisung mit göttlicher Wolken- und Feuersäule, göttliche Errettung vor den Feinden und die Wüste als göttlicher Ort der Offenbarung.
Die Freiheit des Volkes Israel ist also das Geschenk des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Die Freiheit des Volkes Israel ist also das Geschenkt des Gottes Saras, Rebekkas, Rahels und Leas.
Und noch etwas lernen wir aus der Geschichte des Brotes der Freiheit.
Die Befreiung wir nicht als Triumphalismus gefeiert.
Das Jüdische und das biblische Israel werden immer wieder sozialethisch daran erinnert, dass man selbst Sklave war und in Armut lebte. So zum Beispiel bei vielen Begründungen der Gebote. Im wichtigsten Buch der Bibel, dem dritten Buch Mose heißt es z. B. (3. Mo0se 19):
„33 Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. 34 Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott.“
Und natürlich kennt der pharisäisch geschulte Völkerapostel dieses Denken, wenn er der römischen Gemeinde einschärft (Römer 12,15). „Freut euch mit den Fröhlichen! Weint aber auch mit den Trauernden!“
Liebe Gemeinde!
Biblische Freiheit ist also immer auch eine göttlich gesetzte, wenn ihr so wollt, metaphysisch gegründete Freiheit.
Und biblische Freiheit wird immer auch eine Freiheit zu etwas.
So denkt das die Bibel: Freiheit ist immer eine Freiheit zu etwas, für etwas, eben verdankte Freiheit.
Und von dieser so gründeten Freiheit ist man frei, etwas frei und souverän in der Welt zu tun. Zum Beispiel die Gebote Gottes zu halten!
Nur geschenkte und verdankte Freiheit ist wirklich frei. Das lehrt das Brot der Freiheit.
Das ist etwas völlig anderes als es der Sponti-Spruch „High sein, frei sein, Terror muss dabei sein“ intoniert. Und dann frißt die Revolution ihre Kinder.
Das ist etwas völlig anderes als der Freiheitanspruch der Autokraten, amerikanischer, russischer oder chinesischer Provenienz. Und dann werden sich diese Ansprüche der Autokranten gegenseitig nivellieren.
Das ist etwas völlig anderes als die Rautenfreiheit, wo Deutschland im Grunde in eine vermeintliche Schlafwagenfreiheit eingelullt wurde. Und jetzt müssen wir um unsere Freiheit kämpfen, wie es der Kritiker des Islam Hamed Abdel-Samad in seinem Buch „Preis der Freiheit“ schreibt.
Aber werden wir nicht zu politisch.
Kommen wir lieber zur zweiten biblischen Brotsorte, wenn man das Manna heute mal so als Ersatzbrot bezeichnen darf.
Nach den Mazzen, das Manna und damit das Sabbatbrot.
Im Predigtwort heißt es ja: „49 Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. 50 Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe.“
Im Ort der Offenbarung, der Wüste, nährte Gott sein Volk mit Manna.
In der jüdischen Tradition wird gelehrt, dass das Manna, das über 40 Jahre in der Wüste geben wurde den Israeliten Zeit gab, das Wort Gottes zu lernen. Ohne die Sorge um das tägliche Brot konnte also die Tora studiert werden, also die Gebote und Lebensweisen jüdischen Lebens (Wenig, 164).
Und das wäre was, wenn die Kirchen wieder anfingen das Wort zu lernen und zu studieren!
Und der Pastor ein Pastor legens wäre. Und nicht ein pastor theatralicus und dergleichen mehr.
Am Schabbat werden dann zwei Sabbatbrote gebacken.
Eben weil Gott schon in der Bibel immer doppelte Ration gab.
Damit konnte die Freiheit des Schabbats ganz Gott gewidmet werden.
Das ist ja das beste Schöpfungsprodukt des Schöpfungsprodukt: Gott hat am siebten Tag das aller Beste geschaffen. Zeit für Gott. Eine sabbatliche Kultur!
Und das kann man schön beobachten, wenn wir mit Jüdinnen und Juden den Schabbat feiern.
Da wird richtig Brotzeit gemacht. Da wird richtig mit den Kindern getafelt und gespielt.
So sage ich mir, hatte mein Essen mit meinem Großvater fast etwas sabbatliches.
Im Grunde war das ein Moment einer sabbatlichen Kultur mitten in einem einfachen christlichen Haushalt. Einer Kultur der Unterbrechung und deshalb der Freiheit.
Daran erinnert ja das Sabbatbrot und der Segen über das Brot: Wir sind Kinder Gottes.
Eben nicht verzweckt als Arbeits-, Konsum- Steuer- und was weiß ich für -Sklaven.
Wir sind frei Geschöpfe des Höchsten, der die Gotteszeit geschenkt hat, die Brotzeit des Himmels auf Erden.
Liebe Gemeinde!
Zweimal haben wir schon Brotzeit gemacht.
Mit dem Brot der Freiheit von der in Gott gegründeten Freiheit gehört.
Mit dem Ersatzbrot des Mannas von der Freiheit einer sabbatlichen Kultur.
Und zum Schluss zum Brot des letzten Mahles Jesu: Brot der Ewigkeit. Eine Brotzeit ewigen Heils.
Nur die letzten Brotzeit befreit und von der Vergänglichkeit.
Johannes schreibt ja:
„47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige Leben. 48 Ich bin das Brot des Lebens. 9 Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. 50 Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. 51 Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.“
Das Abendmahl ist für uns die Brotzeit auf den Weg in die Ewigkeit.
Als Pilger kosten wir mitten in der vergänglichen Zeit von der Ewigkeit.
Liebe Schwestern und Brüder: Wichtig ist, dass wir unser Leben in Christus gründen, im Brot des Lebens.
Das macht uns frei von der Welt.
Ja, manchmal frage ich mich, ob die Christinnen und Christen deshalb mehr Frei-von- Etwas- Leben als Jüdinnen und Juden ihr religiöses Leben immer als „Frei-zu-etwas“ gestalten.
Ja, manchmal frage ich mich, ob das Christentum deshalb mehr Lebensverzicht und Askese hervorgebracht hat als das Judentum lebenszugewandt, witzig und fröhlich lebt.
Ja, manchmal frage ich mich, ob bei uns deshalb die Orthodoxie und dort die Orthopraxi eine so große Rolle spielen.
Aber das ist vielleicht zu holzschnittartig.
Wir wollen ja nicht, dass aus der Brotzeit eine plumpe Stammtischjause wird.
Liebe Gemeinde!
Gehen wir heute nach Hause von der Brotzeit mit Geschmack verdankter Freiheit.
Mit der Gewürzmischung Armut-Freiheit.
Mit einer sabbatlichen Esskultur und Christus als Brot des Lebens, als Befreier und Retter.
Luther hatte tiefste Erfahrungen der Freiheit beim Studium der Heiligen Schrift gemacht.
Hier hat sich ihm die christliche Freiheit in ihrer ganzen Tiefe erschlossen.
Zur Freiheit hat uns Christus befreit, hat Luther im Brief des Apostel Paulus gelesen.
Und das bedeutete für Luther eine Theologe des Kreuzes. Der gekreuzigte und auferstandene Christus ist der Grund seiner Freiheit. Das Wort vom Kreuz hat Luther wieder und wieder verkostet. Es war seine Leibspeise. Eine ewige Brotzeit mit dem Wort vom Kreuz!
Und warum nicht nach Hause gehen und nochmals Brotzeit gemacht.
Mit dem Wort vom Kreuz. Also gesegnete Mahlzeit und Freiheit!
Amen!
Kanzelsegen: „Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ Gemeinde: Amen.
3. Fastenpredigt
“Freiheit, Selbstbestimmung und Hingabe – was kann die Psychiatrie und Psychotherapie hierzu beitragen”
mit Prof. Dr. med. Thomas Kraus, Johanniskirche Lauf 2025
Predigttext Johannes 18,28-19,5 – Ein scheinbar wehrloser König
Liebe Mit-Christinnen und Mit-Christen,
wir befinden uns in der Fastenzeit – einer Zeit der Reflexion, des Verzichts und der inneren Neuausrichtung. Es ist eine Zeit, in der wir uns fragen (insbesondere angesichts der weltpolitischen Umbrüche): Wie frei sind wir eigentlich – und wie lange noch? Was bedeutet es, frei zu sein? Was heißt es, wahrhaft frei zu sein?
Ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium zeigt uns eine zutiefst paradoxe Situation: Jesus steht vor Pilatus, er ist gefangen, misshandelt, verspottet – was hat das mit Freiheit zu tun?
Hören wir den Text aus Johannes 18,28 – 19,5:
„Sie führten Jesus von Kajaphas zum Prätorium; es war früh am Morgen. (…) Pilatus ging zu ihnen hinaus und sagte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? (…) Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. (…) Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. (…) Pilatus trat wieder hinaus und sagte: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus, trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch!“
Ein bedrückender Text, wie ich finde, aber gleichzeitig ein schockierend aktueller! Ich denke hier sofort an die ungerechten Verhaftungen von Regimegegnern, die wir derzeit wieder zuhauf erleben. Und es fällt mir Dietrich Bonhoeffer ein, der ebenfalls hätte fliehen können, der es stattdessen als seine Aufgabe sah, freiwillig im Land zu bleiben – und damit ins Konzentrationslager und schließlich den Tod zu gehen. Was für ein Mensch!
Jemand der äußerlich vollkommen unfrei ist, entscheidet sich bewusst und innerlich frei, seiner Berufung zu folgen, auch wenn sie in den Tod führt, vielleicht um ein Zeichen zu setzen, dass die innere Freiheit nie zu beschränken ist durch äußeren Zwang. Eine Selbstaufopferung aus einer Mission heraus – also für andere, für uns – wie bei Jesus.
Auf der anderen Seite sehen wir in der Psychiatrie und Psychotherapie immer wieder Menschen, die aus Selbstaufopferung ins Burnout gerutscht sind, sie sind meist schwer depressiv und wollen manchmal nicht mehr leben. Was ist hier der Unterschied zum vorigen Fall? Jemand der äußerlich vollkommen frei ist, wird innerlich von solch massiven Zwängen, Unsicherheiten und Abhängigkeiten geplagt, dass er nicht mehr nein sagen kann, wenn es darum geht, auch mal eine Pause einzulegen, oder den pflegebedürftigen Angehörigen einmal in die Kurzzeitpflege zu geben, oder dem Chef in der Arbeit gegenüber nein zu sagen, wenn er weitere Arbeit in der Freizeit und am Wochenende einfordert. Wo kommt diese innere Unfreiheit her? Manchmal aus schlechtem Gewissen, aus eingeimpften Schuldgefühlen oder übertragenden Leistungsansprüchen. Manche fühlen sich nur gemocht, wenn sie Übermenschliches leisten, manche erhoffen sich endlich Lob und Liebe von den Eltern zu bekommen, auch wenn diese vielleicht schon tot sind. Dann fällt mir oft der Spruch Jesu ein, „der Lahme kann nicht dem Kranken helfen“. Er verlangt also diese Form der Selbstaufopferung gar nicht von uns.
Fassen wir zusammen: es gibt auch äußere Unfreiheit bei maximaler innerer Freiheit und maximale äußere Freiheit bei vollkommener innerer Unfreiheit.
Was ist überhaupt Freiheit und wie hängt sie mit Selbstbestimmung und Selbst-Verantwortung zusammen?
1. Freiheit – die Basis eines gleichschenkligen Dreiecks
Freiheit bedeutet im Kern die Möglichkeit, zwischen Alternativen zu wählen. Sie kann sich auf äußere Umstände (z. B. politische oder finanzielle Freiheit) oder innere Prozesse (z. B. Angst-Freiheit, Willensfreiheit) beziehen.
Ein depressiver Mensch mag äußerlich alle Freiheit der Welt haben – doch in seinem Inneren fühlt er sich wie in einem Gefängnis. Jemand mit einer Angststörung vermeidet bestimmte Situationen, weil sie ihn zu sehr überfordern. Ein Suchtkranker erlebt den bitteren Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Kontrolle und dem Zwang seines Verlangens. Und wir alle kennen die inneren Kämpfe zwischen dem, was wir eigentlich wollen, und dem, was wir aus Angst, Bequemlichkeit oder Gewohnheit tun.
Freiheit lässt sich also auch unterscheiden in:
Negative Freiheit: Freiheit von äußeren und inneren Zwängen (z. B. keine Diktatur, keine Bevormundung, keine befehlenden Stimmen im Kopf). Oder:
Positive Freiheit: Freiheit zu – also die Fähigkeit, das eigene Leben bewusst zu gestalten, also über sich selbst zu bestimmen.
Freiheit ist dabei die Voraussetzung für Selbstbestimmung – aber allein, als Freiheit an sich ist sie noch nicht sinnvoll. Ohne Reflexion kann sie in Willkür, Egoismus oder sogar in die Selbstzerstörung führen.
2. Selbstbestimmung – die Ausgestaltung der Freiheit
Selbstbestimmung bedeutet, das eigene Leben bewusst und reflektiert zu gestalten – auf der Grundlage der eigenen Werte, Bedürfnisse und Überzeugungen.
Sie setzt Freiheit voraus, denn man kann sich nur selbst bestimmen, wenn man auch entscheiden darf.
Sie erfordert aber auch innere Reife, z. B. die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, Selbstkritik, Impulskontrolle und Perspektivübernahme.
Psychisch gesunde Menschen können in der Regel selbstbestimmt handeln, davon gehen wie aus. Bei schweren psychischen Erkrankungen (z. B. Psychosen, Manien, schwere Depressionen) kann diese Fähigkeit eingeschränkt sein – und dann müssen andere (z. B. Ärzte, Angehörige, rechtliche Betreuer, Richter) über uns in der Krankheit entscheiden. Wir sprechen von Fürsorge. Sie muss engen Grenzen folgen und durch gesellschaftlich festgelegte Regeln (also Gesetze) beschränkt sein. Der sog. natürliche Wille, sich in der Psychose nicht behandeln zu lassen, und den befehlenden Stimmen zu folgen, z.B. sich umzubringen, darf nicht über dem sog. freien Willen stehen, der ohne Krankheit zu einem selbstverantworteten Leben befähigen würde. Es geht also darum, durch – vorübergehenden und maßvollen Zwang zur Behandlung – den krankheitsbedingt verschütteten freien Willen wiederherzustellen. Schwierig – aber nötig – und möglich. Bei ethisch schweren Abwägungen haben wir mittlerweile auch die Möglichkeit geschaffen, ein unabhängiges Ethik-Konsil einzuholen.
Damit sind wir beim Begriff der Verantwortung angekommen, dem 3.Schenkel unseres Dreiecks nach Freiheit und Selbstbestimmung.
3. Verantwortung – die Konsequenz
Verantwortung bedeutet, für die Folgen des eigenen Handelns einzustehen – gegenüber sich selbst, anderen Menschen und der Gesellschaft.
Wer frei ist und sich selbst bestimmt, trägt auch Verantwortung.
Aber wie oft fliehen wir vor dieser Verantwortung! „Ich kann nichts dafür, so bin ich halt.“ „Es ist mir zu anstrengend, mich zu verändern.“ „Die anderen sind schuld an meiner Situation.“ Doch Verantwortung übernehmen bedeutet, dass wir uns nicht nur als Opfer unserer Umstände betrachten. Machen wir uns klar: Wir haben immer eine Wahl!
Verantwortung macht deutlich, dass Freiheit nicht grenzenlos sein kann – denn sie endet dort, wo die Freiheit anderer verletzt wird.
In einer ethisch orientierten Gesellschaft ist Freiheit nie Selbstzweck, sondern immer auch in Beziehung zu anderen zu verstehen. Es besteht eine Verantwortung für das Gemeinwohl, die Fürsorge füreinander.
Fürsorge darf aber auch nicht ausgenutzt werden von autoritären Staaten, die Oppositionelle und Andersdenkende sowie psychisch Kranke ausgrenzen, wegsperren und psychiatrisieren.
Lassen Sie mich wieder zusammen: Wie ist das Zusammenspiel zwischen Freiheit, Selbstbestimmung und Verantwortung?
Freiheit bedeutet, nicht beschränkt zu sein durch etwas oder für etwas.
Freiheit ermöglicht Selbstbestimmung.
Selbstbestimmung ohne Freiheit ist eine Illusion.
Freiheit ohne Verantwortung wird zu Egoismus.
Verantwortung ohne Freiheit führt zu Fremdbestimmung oder autoritärem Zwang.
In einer menschlichen, gerechten und seelisch gesunden Gesellschaft gehören alle drei zusammen – wie drei Seiten eines stabilen Dreiecks
Wie erreicht man nun innere, geistige Freiheit und wie kann uns die Psychiatrie und Psychotherapie dabei helfen?
Das Ziel vieler unserer Therapien ist klar: Freiheit und Selbstbestimmung wiederherzustellen, wenn sie durch Krankheit eingeschränkt sind.
Hierzu können wir mittlerweile auf eine Vielzahl von biologischen Mitteln zurückgreifen wie Medikamente, Hirnstimulationsverfahren, physikalische Reize oder Schlafphasenverschiebungen. Wir greifen also direkt und indirekt in den Gehirnstoffwechsel ein, um krankheitsbedingte Folgen zu normalisieren.
Heißt das, unser Denken ist nur ein Produkt unseres Gehirns, der Geist kann also gar nicht frei sein?
Ja, sagt die moderne Neurowissenschaft, wir sind physikalisch-biologisch determiniert, ein Produkt aus Strahlen, Atomen und Stromflüssen sowie von Zellteilung, Hormonen und Signalübermittlung. Machen wir die Probe: Überlegen Sie, ob ein umfallender Baum ein Geräusch macht, wenn sie viele Kilometer entfernt sind! Wer sagt ja, wer sagt nein? Farben gibt es ebenfalls nicht in der Natur.
Unser Gehirn erschafft unsere Welt, wir bekommen in einer Art Tunnel die Illusion einer Welt vorgespielt, eines Ichs und eines Bewusstseins des Ganzen. Der Philosoph Thomas Metzinger spricht von einem Ego-Tunnel in seinem gleichnamigen Buch. Unsere Wahrnehmung ist prediktiv, also vorhersagend, wir bekommen aus dem Gedächtnis also schon den vorhergesagten nächsten Moment als Ist-Zeit-Erleben eingespielt. Wenn wir gedankenversunken die Straße entlanggehen, merken wir dies nur, falls wir stolpern, denn dann ist ein Vorhersagefehler passiert. Wer von Ihnen hat sich noch nicht schon einmal gewundert, dass er oder sie minutenlang Auto gefahren ist, ohne sich dessen bewusst gewesen zu sein. Unser Gehirn steuerte uns unbewusst, während wir uns einem Gedankenfluss hingegeben haben, den wir meistens ebenfalls nicht initiiert hatten. Das Gehirn hat ausgerechnet, dass das Körperbudget nach mehr Glucose-Zufuhr ruft für die beabsichtigte Autofahrt und hat Hungergefühle eingespielt, ein wenig unangenehm gefühlsmäßig gefärbt, im Bauch lokalisiert und außerdem Gedanken an die Nahrungsbeschaffung verbunden mit der Angst, es nicht rechtzeitig zum Einkaufs-Laden zu schaffen, bevor er schließt. Alles eingespielt. Was ist daran frei? Also sind wir determiniert?
Die Frage nach der Freiheit und einer möglichen Vorbestimmung ist so alt wie die Menschheit und die Philosphiegeschichte selbst. Vor genau 500 Jahren 1525 verfasste hierzu Martin Luther – wie Sie wissen, feiern wir dieses Jahr auch 500 Jahre Reformation im Nürnberger Land – seine berühmte Schrift „De servo arbitrio“ („Vom unfreien Willen“), als Antwort auf den Humanisten Erasmus von Rotterdam, der die Lehre vom freien Willen vertrat. Luther widersprach entschieden: „Der menschliche Wille vermag nichts als sündigen.“ Luther sah den Menschen als nicht fähig an, aus eigener Kraft das Heil zu erlangen („verderbt“). Sein Wille sei durch die Sünde so sehr gebunden, dass nur Gott ihn befreien könne. Der Mensch sei also nicht wirklich frei in seinen Entscheidungen, sondern stehe immer unter einem Einfluss – entweder der Gnade Gottes oder der Macht der Sünde.
Manche sahen in dieser Lehre einen radikalen Determinismus: Wenn der Mensch keinen freien Willen hat, ist er dann überhaupt verantwortlich für sein Handeln? Das gleiche gilt für den neurowissenschaftlichen Determinismus. Kann eine Gesellschaft überhaupt jemanden bestrafen, wenn es gar keine Schuld gibt?
Wie kommen wir hier nun zu einer Lösung? Gibt es doch einen freien Willen?
Evolutionsbiologisch brachte es dem Menschen Vorteile, abstrakte Begriffe zu entwickeln wie Freiheit, Schuld, Gemeinsinn oder Liebe. Dadurch konnten sich Gesellschaften bilden, die gemeinsam besser überleben konnten. Der Ego-Tunnel ist also vernetzt, d.h. es gibt sich verzweigende Röhren. Und wie die Evolution ein lernendes System ist, so können wir innerhalb dessen auch erziehen und therapieren – und damit den Menschen verändern, formen und ein- oder ausgliedern aus unserer Gesellschaft. Der Determinismus hat also zumindest eine Änderungs-Perspektive in die Zukunft. Auch oder gerade wenn es nur eine Illusion ist, können wir sie uns trotzdem zunutze machen für ein Wirken und Verändern in der Welt.
Doch, reicht uns das? Wo ist der Geist bei alledem geblieben? Ist wirklich alles Geistige aus, wenn unser Gehirn nicht mehr arbeitet? Gibt es nicht wenigstens Teile eines höheren Geistes in uns, die überleben und sich vielleicht im (denkbaren) Jenseits vereinen – mit dem höheren Geist, also mit Gott? Gibt es überhaupt einen Sinn ohne ihn? Hier setzt der Glaube ein.
Als gläubige Menschen tun wir uns also in vielerlei Hinsicht leichter. Wenn alles einen Sinn haben soll und einen Anfang, dann geht dies nicht ohne einen Verursacher und evtl. Zielgeber. Also nicht ohne einen Geist. Weil wir glauben, gibt es einen Geist.
Und was sagt nun Luther zum Determinismus-Vorwurf? Luther meinte nicht, dass der Mensch keine Wahl habe – sondern dass er ohne Gottes Hilfe nicht das Gute wählen könne. Die Freiheit zur wahren Entscheidung kommt erst durch Gottes Gnade.
In der Psychiatrie verwenden wir nicht nur biologische Mittel, nein wir führen intensiv Gespräche, führen Psychotherapie durch. Psychiatrie ist Beziehungsmedizin. Wir helfen Patientinnen und Patienten einen freien Kopf zu bekommen, frei zu werden von ihren belastenden Gedanken, ihrem Grübeln und ihren Sorgen. Sie sollen ihren Geist wieder selbst steuern. Geht das denn? Kann man den Gedankenfluss stoppen? Können wir überhaupt „nicht-denken“? Machen wir folgendes kleines Experiment: Achten Sie einmal ganz genau auf den Beginn Ihres nächsten Gedankens!? Bei wem ist einer gekommen? Bei wem nicht? Na also. Wir können ja doch Gedanken steuern!?
Halten Sie nun inne und fixieren Sie mit den Augen einen Punkt vor Ihnen, betrachten Sie genau dessen Struktur für wenige Sekunden. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit nun Ihrem Atem zu und genießen Sie einen langsamen, bewussten Atemzug. Gönnen wir uns noch einen kurzen Moment der Stille.
Diese Übung der Achtsamkeit sollten Sie mehrmals täglich wiederholen, auch indem Sie sich eine Pflanze betrachten, ein Bild oder einen interessanten Gegenstand. Die Autoren des Buches „Achtsamkeit to go“ beschreiben heilende Wirkungen ähnlich einer längeren Meditationsarbeit am Stück – nur eben kürzer.
Patienten, die schon morgens und abends im Bett von Ängsten oder Grübelgedanken geplagt werden, lernen z.B., sich auf einen Punkt an der Decke oder die Geräusche der Umgebung wie das Zwitschern der Vögel, zu konzentrieren, sie beobachten ihre Atmung, zählen rückwärts von Hundert, sagen positive Sätze (sog. Affirmationen) wie „Ich vertraue auf meine innere Stärke“ oder sie sprechen ein Gebet, wenn sie gläubig sind. Wenn sie keinen religiösen Hintergrund haben, nutzen viele gerne die uralten Metta-Sätze „Möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich behütet und beschützt sein, möge ich in Frieden und in Leichtigkeit leben“. Sie lernen also, ihre Gedanken zu steuern, sie nicht mehr ihrem freien Lauf zu überlassen, der nichts anderes als ein gespeichertes falsches (eben krankes) Konzept darstellt, das ihnen ständig vom Gehirn eingespielt wird.
Was erreichen wir also mithilfe dieser Achtsamkeitstechniken? Wir treten heraus, aus dem Auto-Pilot-Modus unseres Gehirns, wir bestimmen nun wieder selbst, was der Inhalt unseres Bewusstseins ist, wissend, dass wir unsere Gedächtnis-Konzepte damit umschreiben, positives Denken ruft positive Gefühle hervor und verändert unser Handeln, das wiederum auf die Gefühle zurückwirkt. Außerdem erzeugen wir bewusst und selbst neue Vorhersagefehler im neuropsychologischen Sinn, d.h. wir kommen tatsächlich in die Wirklichkeit (selbstverständlich innerhalb unseres Tunnels) und leben eine Zeitlang in der Echtzeit. Deshalb ist es auch anstrengender und erschöpfender und wir können es nicht dauerhaft durchhalten- dafür werden wir aber mit der Zeit immer besser darin, Achtsamkeit ist eine Lebensaufgabe.
Mithilfe von Psychotherapie und Achtsamkeitstechniken wird gedankliche Steuerung erreicht und damit innere Freiheit erzeugt, die volle Selbstbestimmung wird möglich. Ein verantwortliches Leben kann daraus resultieren.
Der Kreis schließt sich wieder und ich komme zurück auf das Zusammenwirken von Freiheit, Selbstbestimmung und Verantwortung. Martin Luther drückt dies wunderbar aus in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520) mit folgenden Worten:
„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan.
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“
Der erste Satz betont die Freiheit und Selbstbestimmung des gläubigen Menschen: Durch den Glauben ist er frei von äußerem Zwang, sogar von Gesetzlichkeit, auf jeden Fall von Schuld.
Der zweite Satz zeigt, dass diese Freiheit nicht zur Willkür führt, sondern zur Verantwortung und Hingabe an andere. Der christliche Mensch handelt aus freiem Willen zum Dienst – nicht aus Zwang also, sondern aus Liebe und Hingabe.
Luther bringt hier auf den Punkt, dass wahre Freiheit immer Verantwortung einschließt, und dass Selbstbestimmung nicht egoistisch, sondern beziehungsorientiert gelebt werden soll.
Kommen wir damit nochmals auf den heutigen Predigttext zurück.
Jesus lebt uns einen radikalen Freiheitsbegriff vor, die höchste Form der Freiheit zu etwas – nämlich die Hingabe an seine höhere Bestimmung, seine Mission, an den Gehorsam seinem Vater gegenüber und dessen Willen. Selbstaufopferung aus vollkommener Freiheit heraus – nicht aus innerem Zwang oder falsch verstandenem Selbsterlösungswillen heraus. Seine Freiheit war nicht die eines Rebellen, sondern die einer tiefen inneren Überzeugung.
Jesus sagt in Johannes 10,18: „Niemand nimmt es [mein Leben] mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin.“
Diese Freiheit unterscheidet Jesus von Pilatus, von den Hohenpriestern, von der tobenden Menge: Pilatus ist gefangen in seiner Angst vor Rom und dem politischen Druck. Die Hohenpriester sind gefangen in ihren Vorstellungen von Macht und Gesetz. Die Menge ist gefangen in ihrem blinden Hass und ihrer Manipulierbarkeit.
Jesus allein bleibt frei, weil er nicht aus Angst oder Zwang handelt, sondern aus Liebe. Und was geschieht? Pilatus bringt ihn hinaus und sagt: „Seht, der Mensch!“ Ja, genau das ist er: Der wahre, vollkommene Mensch. Der Mensch, der sich selbst hingibt – nicht aus Schwäche, sondern aus Freiheit.
Hierin liegt eine tiefe geistliche Wahrheit: Wahre Freiheit ist nicht die Fähigkeit, alles tun zu können – sondern die Fähigkeit, das Gute zu wählen. Insbesondere in der unserer modernen Welt, in der wir oft hören: „Ich bin frei, wenn ich mich nicht einschränken lasse, wenn ich tun kann, was ich will.“ Aber sind wir wirklich frei, wenn wir jedem Impuls nachgeben? Ist der Süchtige frei, der nicht aufhören kann zu konsumieren? Ist der von Zorn erfüllte Mensch frei, der nicht vergeben kann? Nein. Wahre Freiheit liegt nicht im Beliebigen, sondern im Wahren.
Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir jeden Tag vor einer Entscheidung stehen: Leben wir eine Freiheit, die sich selbst genügt – oder eine Freiheit, die sich verschenkt?
Und genau hier setzt die Fastenzeit an – quasi als persönliche Einübung der echten Freiheit:
Wir fasten nicht, um uns zu quälen. Wir fasten, um uns selbst besser zu verstehen. Wir fasten, um zu spüren, dass wir nicht von äußeren Dingen abhängig sind. Wir fasten, um neu zu lernen, was es bedeutet, wahrhaftig frei zu sein.
Denn die wahre Freiheit beginnt nicht draußen in der Welt – sie beginnt in uns selbst.
Wenn Sie möchten, dann stellen Sie sich folgende Fragen:
Was hält mich davon ab, wirklich frei zu sein? Gibt es Ängste, die mich einschränken? Gibt es Gewohnheiten, die mich steuern? Gibt es Dinge, die ich loslassen müsste, um freier zu werden?
Vielleicht ist genau diese Fastenzeit eine Gelegenheit, sich diesen Fragen zu stellen. Nehmen Sie sich die Zeit! Wenn nicht jetzt, wann dann? Planen Sie für sich selbst täglich Zeit ein, 10 min morgens und abends, meditieren Sie, schreiben Sie Tagebuch, gehen Sie achtsam mit allen Sinnen spazieren. Beten Sie.
Schalten Sie Ablenkungen aus, gönnen Sie sich Handy freie Zeiten. Lauschen Sie auf die Stille! Die Antwort darauf wird aus Ihrem Herzen kommen!
Ich komme zum Schluss:
Freiheit ist kein Zustand, sondern eine tägliche Entscheidung. Eine Entscheidung, sich nicht fremdbestimmen zu lassen, nicht von äußeren und inneren Zwängen, von Ängsten oder Gewohnheiten. Eine Entscheidung für Selbstverantwortung und innerer Klarheit.
Die Fastenzeit ist nicht in erster Linie eine Zeit des Verzichts, sondern eine Zeit der wahren Befreiung. Wahre Freiheit ist Hingabe. Jesus hat uns zur Freiheit befreit. Leben wir sie!
Amen.
Herzliche Weihnachtsgrüße aus der Evangelischen Kirchengemeinde Lauf
Unsere wunderbare Puppenmacherkrippe in der Johanniskirche Lauf grüßt Euch mit diesem kleinen Film:
Der Text im Film stammt von Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann.
“Puppenmacherkrippe” heißt sie, weil eine berühmte Künstlerin diese einmalige Krippe mit lebendig anrührerenden Figuren geschaffen hat.
Herzlichen Dank für die Verbundenheit, Zusammenarbeit und Freundschaft in und mit unserer vielfältig aktiven Kirchengemeinde. Ein wunderbares Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr 2025 wünschen wir!
Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus
Ihre Hauptamtlichen aus der Kirchengemeinde Lauf!
segne und behüte euch.
Er lege seinen Sohn euch ans Herz
und mache euer Leben menschlich.
Er lasse sein Licht leuchten über euch
und erwärme euch mit seiner Liebe.
Er fülle eure Häuser und Familien
mit seinem Frieden.
Kleiner Tipp: Hier kannst du die Johanniskirche virtuell mit einem 360 Grad Panorama besuchen und vieles erfahren.
„Ein Moment der Ehrfurcht und der Rührung“ – Verabschiedung und Einführung des Kirchenvorstandes im Festgottesdienst in der Johanniskirche Lauf am 1. Advent
Mit einem feierlichen Gottesdienst und zahlreichen Gemeindemitgliedern wurde am vergangenen Sonntag der neue Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Lauf eingeführt. Die Zeremonie war geprägt von bewegenden Reden, musikalischen Darbietungen durch JohannisBrass und einer gemeinschaftlichen Atmosphäre der Hoffnung.
Schon am 20. Oktober wurde für die evangelischen Kirchengemeinden und Dehnberg ein gemeinsamer Kirchenvorstand gewählt. 17 Kandidierende standen zur Wahl. 1276 von 6125 wahlberechtigten Gemeindemitgliedern haben ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung blieb gegenüber 2012 nahezu unverändert bei 21%.

Bild 1: Die neuen Kirchenvorstehenden mit den PfarrpersonenVon links nach rechts: Hans Walter, Annemarie Wiehler, Pfarrerin Margitta Dümmler, Hans-Helmut Heller, Therese Stübinger, Pfarrer Thomas Reuß, Joachim Wartha, Veronika Strittmatter (Wahlbezirk 2 Günthersbühl), Pfarrerin Lisa Nikol-Eryazici, Michael Steeger, Pfarrer Jan-Peter Hanstein, Dr. Matthias Seybold, Jane Dubrikow, Thorsten Franke, Bernd Beyer, Heiko Brandt, Jutta Schmitt. Bild H. Betzold
Pfarrer Hanstein feierte in seiner Predigt passend zum 1. Advent und dem Lied „Macht hoch die Tür“ die Kirchenvorstände als „Türhüter“, die helfen, die Türen der Gemeinde offen zu halten und anderseits wachsam auf das Kommen von Jesus zu warten. Die Botschaft war klar: Offene Türen und offene Herzen für Jesus und alle, die zu ihm kommen möchten.
Der Kirchenvorstand Lauf hat in den Jahren 2018-2024 Hervorragendes geleistet und wichtige Meilensteine erreicht. Dazu zählen die Einweihung des neuen Kindergartens Arche Noah im Jahr 2019, der erfolgreiche Umgang mit den Herausforderungen des Corona-Lockdowns und die Einführung von Livestream-Gottesdiensten, die Sanierung der Dorfkirche Günthersbühl sowie die Umsetzung der Landesstellenplanung und Gottesdienstreform. Besonders hervorzuheben ist die nachhaltige Sanierung der Christuskirche, die nun einen neuen Raum für vielfältige Formate bietet. Der Vorsitzende Pfarrer Jan-Peter Hanstein dankte den scheidenden Vorstehenden für ihr unermüdliches Engagement und ihre wertvolle Arbeit. Nun ist es an der Zeit, Abschied von dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu nehmen und nach vorne zu schauen. Gott hilft uns, anzunehmen und loszulassen. Bei manchen Kirchenvorstehern flossen Tränen der Rührung in der Erinnerung an 6,12 oder sogar 18 Jahre Kirchenvorstand:

Von links nach rechts mit den Pfarrern hinten: Holger Wielsch, Elena Tempesti, Roland Kraft, Sabine Lipski, Friedrich Utz, Anita Naßler, Ruth Kolb, Gerlinde Höcherl, Dr. Heiner Schächtele, Kerstin Ströbel-König, Claudia Held, Renate Siebert, Karlheinz Backöfer, und. Dagmar Taschenberger. Bild H. Betzold
Alle wurden je einzeln mit Applaus der Gemeinde verabschiedet mit einer Urkunde und einem Geschenk. Schließlich wurde der Segen Gottes erbeten, um die neuen Kirchenvorstände in ihrer wichtigen Aufgabe zu unterstützen und zu leiten. Vor Gottes Angesicht und vor der Gemeinde gelobten die KirchenvorsteherInnen, ihr Amt in Verantwortung vor Gott und im Gehorsam zum Evangelium von Jesus Christus auszuführen. Sie verpflichteten sich, aktiv am kirchlichen Leben teilzunehmen und beim Aufbau der Gemeinde und Landeskirche mitzuwirken, stets nach bestem Wissen und Gewissen. Sie werden die großen Kirchengemeinde Lauf mit Dehnberg mit 7000 Mitgliedern, 700 Ehrenamtlichen, 100 Angestellten und vielen angeschlossenen Vereinen und Stiftungen repräsentieren und gemeinsam mit den PfarrerInnen bis 2030 leiten.
Mit der Feier des Heiligen Abendmahls fand die Feier ihren Höhepunkt, bevor die Gemeinde auszog und ein fröhlichen Ausklang auf dem Kirchplatz mit Kaffee und Kuchen feierte. Die Kirchengemeinde Lauf schaut trotz aller Veränderungen in der Gesellschaft zuversichtlich in die Zukunft. Text JP Hanstein
Über den Tod und das Leben

In der heutigen Podcastfolge von „Der Doppelte David“ tauchen wir in das tiefgründige Thema „Über den Tod und das Leben“ ein. Passend zum heutigen Feiertag “Allerheiligen”, einem Tag des Gedenkens an Verstorbene, geht es im Gespräch mit Dominik, einem Palliativpfleger, um seine Sichtweise auf den Tod. Hat er Angst oder Respekt vor dem Ende? Welche Erfahrungen hat er in der Sterbebegleitung gemacht, und was können wir daraus lernen?
Wir laden euch ein, mit uns über existenzielle Fragen nachzudenken: Was würdest du tun, wenn du nur noch eine Woche zu leben hättest? Diese Überlegungen sind nicht nur wichtig für das eigene Leben, sondern helfen auch, den Glauben und die Hoffnung neu zu betrachten.
Wie immer möchten wir euch ermutigen, Themen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen – sowohl aus einer christlichen als auch aus einer wirtschaftlichen Sichtweise. Lasst uns gemeinsam neue Gedankenanstöße finden, die den Glauben stärken und uns helfen, das Leben in seiner Vollständigkeit versuchen zu begreifen.
Hört rein auf www.derdoppeltedavid.de und seid dabei, wenn wir differenziert diskutieren und Ideen für den Alltag entwickeln.
Allianz gegen Rechtsextremismus – Metropolregion Nürnberg
Unsere Kirchengemeinde Lauf ist über das Dekanat Hersbruck Mitglied bei der Allianz gegen Rechtsextremismus – Metropolregion Nürnberg.
In diesen Zeiten ist dieses Engagement wichtiger denn je.
Ansprechpartner ist Pfarrer Jan-Peter Hanstein.
ALLIANZ GEGEN RECHTSEXTREMISMUS
IN DER METROPOLREGION NÜRNBERG
c/o Menschenrechtsbüro
Fünferplatz 1
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 – 231 90 587
kontakt(at)allianz-gegen-rechtsextremismus.de
Das vorläufige Gesamtergebnis der Wahl des Kirchenvorstands Lauf 2024-2030
Die Kirchengemeinde hat mit sehr guten 21% Wahlbeteiligung gewählt. Noch ist das Ergebnis nicht amtlich.
Es besteht die Möglichkeit, die Wahl innerhalb der Frist von einer Woche nach Veröffentlichung bis zum 28.10.2024 beim vorsitzenden Mitglied des Vertrauensausschusses Pfarrer Jan-Peter Hanstein anzufechten. Das Verfahren der Wahlanfechtung ist in § 20 KVWG geregelt. Die Anfechtung kann nur damit begründet werden, dass gesetzliche Vorschriften verletzt worden sind und dadurch das Wahlergebnis beeinflusst worden ist.

Es wurden 10 Kirchenvorstehende für 3 Stimmbezirke gewählt. 3 werden in der 1. Sitzung am 14.11. noch berufen und werden damit ebenfalls stimmberechtigt sein. Die hauptamtlichen PfarrerInnen sind geborene Mitglieder.
Sehr schön ist, dass die Kandidatinnen der Stimmbezirke Günthersbühl (2) und Dehnberg (3) es auch nach dem Ergebnis unter die ersten 10 geschafft haben.


Hier ist die vorläufige Statistik des Wahlverhaltens nach Alter und Geschlecht:

Ehrenamtliche gesucht
Unser gemeindliches Leben wächst und verändert sich. Für verschiendene Aufgabenfelder suchen wir ehrenamtliche Unterstützung. Vielleicht ist hier was für Sie dabei, wo Sie sich mit Ihrem Gaben und Fähigkeiten einbringen wollen:
Gottesdienst-/Planungsteam St. Jakob
Wir begleiten das gottesdienstliche Leben in St. Jakob, geben Impulse für kreative Gottesdienste, engagieren uns beim Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst oder bei andearen Festivitäten.
Ansprechpartnerin: Pfarrerin Lisa Nikol-Eryazici, Tel. 2202,

Kindergottesdienstteam St. Jakob
Seit einigen Monaten feiern wir parallel zum 14tägigen Gottesdienst auch Kindergottesdienst. Wir freuen uns über Verstärkung, auch Jugendliche, die Freude an der Begleitung von Kindern haben, sind herzlich willkommen.
Ansprechpartnerin: Pfarrerin Lisa Nikol-Eryazici, Tel. 2202,

Wichtelgottesdienstteam
5-mal im Jahr feiern wir den Wichtelgottesdienst. Als Team überlegen wir uns die Themen und setzen sie mit viel Freude und Kreativität kindgerecht um.
Ansprechpartnerin: Pfarrerin Lisa Nikol-Eryazici, Tel. 2202,

Mitarbeit am Salvatorfriedhof
Der Salvatorfriedhof ist nicht nur ein Friedhof für Baumbestattungen, sondern auch ein Naturparadies. Neben den Bäumen wachsen auch viele Rosen und andere blühende Gehölze, die der Pflege bedürfen. Wenn Sie Freude haben an leichter Gartenarbeit inmitten der schönen Natur, dann melden Sie sich.
Ansprechpartnerin: Pfarrerin Lisa Nikol-Eryazici, Tel. 2202,

Churchpool – Eine App für die Gemeinde
Wir haben eine neue App zur gemeindeinternen Kommunikation eingeführt. Der offizieller Startschuss war am Jahresempfang der ehrenamtlichen Mitarbeiter am 16. Mai 2024.
Churchpool ist ein Messenger mit speziellen Funktionen, der für Gemeinden entwickelt wurde.
Warum jetzt noch eine App mehr? Tun es denn die bisherigen Messenger nicht auch? – Berechtigte Frage. Es gibt einige Punkte, in denen sich diese App von den anderen Diensten wie WhatsApp oder Signal abhebt. „Technisches“ Hauptargument ist die Datensicherheit. Die App ist konform der DSGVO, dem Kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) und den Datenschutzbestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) entwickelt worden. Alle Datenübertragungen innerhalb der App erfolgen über eine sichere Verschlüsselung und die Server von Churchpool befinden sich in Deutschland, überflüssige Daten werden nicht gesammelt oder gespeichert.
Die Chatfunktion ermöglicht den direkten Kontakt der Gemeindemitglieder zu den Hauptamtlichen und untereinander. Es können auch Gruppen gebildet werden, die dann unter sich kommunizieren. Das ist praktisch für Eltern, Jugendgruppen, Vorstände, Ehrenamtliche usw.


Die App hat einen Infobereich für kommende Events und Termine der Gemeinde, der automatisch aktuell gehalten wird. Der Gemeindebrief ist direkt mit integriert und selbst Livestreaming ist möglich.
Mit diesem Angebot an Funktionen kann die Kommunikation innerhalb der Laufer Gemeinde in einer einzigen App erfolgen.
Darüber hinaus ermöglicht es Churchpool, Gruppen und Veranstaltungen auch von anderen angeschlossenen Gemeinden zu abonnieren und sich mit ihnen zu vernetzen. Das schafft Reichweite für eigene Veranstaltungen und motiviert zur Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg.
Hier ist der Ort um zu erfahren, „was so läuft“.
Die App ist für alle Anwender kostenlos, werbefrei und für die Gemeinde Lauf als Betreiber mit einer Gebühr von 10€ pro Monat (für die gesamte Gemeinde) extrem günstig.
Wir möchten Sie sehr ermutigen, die App zu nutzen.
Podcast – Das Schönste im Leben: Essen

Unsere Interviewpartnerin heißt Thi und ist Expertin für Essen. Für sie ist “Essen der Sinn ihres Lebens” und sie führt einen eigenen Foodblog: www.kawaii-blog.org
Was macht gutes Essen aus und wie wichtig ist Gemeinschaft beim Essen? Denn Gemeinschaft war auch beim letzten Abendmahl ein zentraler Aspekt.


Podcast: Nimm dir mal Auszeit

Wir alle brauchen mal Auszeit vom Alltag. Doch was macht das mit den eingespielten Routinen? Und was, wenn Urlaub zur Flucht vor der Realität wird?
Wir haben uns seit dem letzten Podcast im Dezember 2023 eine Auszeit genommen und starten jetzt wieder voll durch mit gemeinsamen Wanderungen und neuen Podcast-Folgen.


Podcast: Asyl… Ihr habt mich aufgenommen

Asyl: Ein brandheißes Thema das vermutlich jeden schon lange vor und auch weiterhin nach den Landtagswahlen beschäftigt. Wir wollen uns dem Thema nähern und haben versucht Politik außen vor zu lassen und die Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Was sagt Jesus dazu? Matthäus 25, 35: “Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.”
Dazu waren wir wandernd unterwegs auf der Tour “Vor den Toren der Südstadt”.

Diese Wanderung verbindet die Bahnstation Reichelsdorf S2 mit dem Endpunkt der U1 Langwasser-Süd. Zunächst entlang am Eichenwaldgraben führt uns der Weg über den idyllischen Königshof zum Steinbrüchlein (Biergarten/Waldspielplatz). Hier kann man die Tour beenden oder bis zum Zollhaus weiterlaufen


Podcast: Wenn nichts mehr geht, dann geh

360 km zu Fuß: Unser Gast Saskia hat sich während der Corona-Pandemie auf den Weg gemacht, ist den Jakobsweg ab Porto gelaufen und hat dort prägende Momente erlebt.





Wir sprechen mit ihr darüber, warum sie sich auf den Weg gemacht hat und was der Weg aus ihr gemacht hat!
Saskia hat uns am Morgen unserer “Podcast-Wanderung” auf den fränkischen Dünenweg erst Bescheid gegeben, dass sie mitkommt und wir haben sie spontan mit einer Aufnahme überrascht. Das Ergebnis: Sehr bewegend und authentisch!

DÜNEN IN FRANKEN?
so paradox es klingen mag, es gibt sie. Wer aber bei Dünen an flirrende Hitze denkt, der irrt – schneidend kalte Winde und Stürme haben hier in Franken während der letzten beiden Eiszeiten mächtige Dünen aufgetürmt, die die Landschaft bis heute prägen. Flussläufe und Bäche waren ausgetrocknet oder gefroren. Inzwischen sind die Dünen fast überall bewaldet, und die Bäche und Flüsse haben sich einen neuen Lauf gebahnt.
Der Fränkische Dünenweg führt in die wenig bekannte und stille, teils auch herbe Landschaft, die in der jüngsten erdgeschichtlichen Epoche entstanden ist. Es lohnt sich, sie kennen zu lernen, und unterwegs eröffnen sich immer wieder neue Ein- und Ausblicke.


Predigt zu Kolosser 1,13-20 (V). karfreitag lauf Jan-Peter Hanstein
Es hat Gott gefallen durch Christus alles zu versöhnen
Liebe Gemeinde,
und (sie) sahen das alles!
Alles
Alles zu spät.
Alles zu Ende.
Jesus ist alle.
Ja – alle ist Jesus.
Alles gegeben. Alles verloren.
Aber alle gewonnen!
Warum wärest du sonst da, wenn er dich nicht gewonnen hätte.
Du – hier. Unter dem Kreuz.
Du bist nicht zu Hause geblieben. Das wäre zu einfach gewesen.
Du bist doch kein Besucher, kein Hörer, kein Gaffer, kein Teilnehmer.
Und du bist nicht allein hier. Unter dem Kreuz.
Viele sind da. Heute. Nicht alle. Aber darum geht es ja nicht.
DU GLAUBST. DU FÜHLST. DU WEISST.
So viel mehr. Nämlich alles. Nicht alles ist aus.
Er ist Allen Alles geworden.
Das kann man nicht einfach beschreiben oder erzählen.
Vielleicht eher singen. Wie in dem Lied „Alles“ von Judith Holofernes mit ihrer Band „WIR SIND HELDEN“
Alles ist alles ist alles
Dir ist alles erlaubt und alles gegeben
Alles geglaubt und alles vergeben
Und alles wär drin und alles daneben
Es wär alles ertragen und alles vergebens
Und gut
Und gut?
Ach – so vieles war und ist nicht gut. Was ist alles Unversöhnliche gerade am Karfreitag geschehen unter dem Zeichen des Kreuzes. Hass und Vernichtung statt Versöhnung. Wir gedenken der früher regelmäßig ausbrechenden Progrome, der Hass gegen die Juden als den vorgeblichen Mördern des Gottessohnes. Wie oft wurde Jesus noch einmal gekreuzigt durch die christliche Verfolgung der Juden! Deshalb ist es wichtig, unseren Geschwistern dieser Tage zum Pessachfest Glückwünsche zu übermitteln. Wir beten, dass sie friedlich feiern können. Bei uns in Deutschland und in Israel.
Alles gut unter dem Kreuz? Für unsere islamischen Mitbürger, für die ist das Kreuz das gefürchtete Zeichen unbarmherziger Ritter, die ihre Herkunftsländer überfielen, tausende töteten und ausplünderten und dann noch vom Heiligen Krieg sprachen. Am 9. April, am Ostersonntag nach Sonnenuntergang sind wir Laufer eingeladen mit ihnen das Fastenbrechen in der Moschee zu feiern, mitten im Ramadan. Ich werde hingehen.
Alles ist alles ist alles
Dir ist alles erlaubt und alles gegeben
Alles geglaubt und alles vergeben
Und alles wär drin und alles daneben
Es wär alles ertragen und alles vergebens
Und gut
Nein. Noch nicht alles ist vergeben und vergessen. Wie weit sind wir entfernt von der Versöhnung, die in Christus begonnen wurde. Wie weit entfernt vom Frieden. Geschweige denn von der Erlösung. Weiter als ich es jemals gedacht habe.
Aber ich habe einen Wunsch. Keinen Traum, sondern erfüllbar. Ich werde es erleben!
Vielleicht werde ich nicht warten, bis der Krieg in der Ukraine zu Ende ist, sondern ich werde endlich tun, was ich schon lange wollte: Ich werde in die Ukraine fahren. Natürlich auch nach Winnyzia fahren. Die Freunde Larissa, Valeri und Ingret und viele andere dort besuchen und mit Ihnen in diesem kleinen Gemeindehauskirche das Abendmahl feiern. Valeri wird grillen und wir werden feiern. Verhalten, unter Tränen, mit Sorge und mit der Frage: Wann endlich wird es Frieden geben und wieviel länger noch – bis Ukrainer und Russen sich versöhnen?
Deshalb werde ich weiter fahren bis nach Odessa. Dort steht die alte lutherische St.Pauls-Kirche, mit bayerischer Hilfe 2010 saniert. Wie durch ein Wunder hat sie alle Katastrophen und Kriege und Zeitenwenden überlebt. Vorne an der Altarwand hängt ein gestiftetes Kruzifix aus Wenzendorf vor einer modernen Wand-Malerei von Tobias Kammerer.

Zuerst denkt man an einen Sonnenuntergang. Dann sieht man den großen Blutstropfen vom Himmel und darunter angedeutet der Abendmahlskelch, der diese Flüssigkeit auffängt.
„Dieser Kelch ist der neue Bund durch mein Blut.“
Herzblut. Wie eine blutige Träne Gottes. Dort am Kreuz. Gottes letztes Opfer, das er selbst bringt. Wann werden wir aufhören, andere zu opfern und zu töten um irgendwelcher politischen und religiösen Ziele willen?
Aber die Versöhnung nimmt ihren Weg durch uns. Wer hätte gedacht, dass die Ukrainer jemals uns Deutschen vergeben, nach allem, was ihnen im Dritten Reich angetan wurde.
Martin Luther hat gesagt: Christus ist der „Spiegel des väterlichen Herzens Gottes“ (Luther)
Nur die Kirche, nur die Glaubenden, das ist Gott zu wenig. Die Erlösung steht aus. Darauf warten wir mit allen Glaubenden. Muslime, Christen und Juden.
Vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir heute das Glaubensbekenntnis nach dem Evangelium nicht gesprochen haben. Weil der Predigttext so ein Bekenntnis ist. Oder mehr eine Hymne für den, der vor allem war, alles geschaffen hat und allen alles geworden ist und am Ende alles in ihm versöhnt sein wird. Lasst uns diese Worte aus dem Brief an die Kolosser gemeinsam bekennen.
S.1097 im EG: Wir lesen:
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene vor aller Schöpfung.
Denn in ihm wurde alles geschaffen,
was im Himmel und auf Erden ist,
das Sichtbare und das Unsichtbare,
es seien Throne oder Herrschaften
oder Mächte oder Gewalten;
es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.
Und er ist vor allem,
und es besteht alles in ihm.
Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde.
Er ist der Anfang,
der Erstgeborene von den Toten,
auf dass er in allem der Erste sei.
Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen
und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin,
es sei auf Erden oder im Himmel,
indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz.
AMEN.
Jesaja 40, 1-8 Rudolf Landau
11.12.1988 3. Advent in Neunkirchen am Brand

Diese Predigt habe ich selbst gehört 1988 als junger Theologiestudent und ich habe sie nie vergessen. Was soll ich predigen? Was kann ich predigen? Wie soll ich je besser predigen als mein freundlicher Lehrmeister Rudolf Landau, der in unserer Kirchengemeinde wohnte und versuchte, in Erlangen über die “Christologie der heutigen Predigt” zu habilitieren. Wer seine Predigt hört, wird verstehen, warum er sich nach einiger Zeit angeödet von der lauen Christologie seiner Zeitgenossen von diesem Thema abwendete… JPH 2022
Liebe Gemeinde! Auch über das von Erdbeben und Kriegen und vom Flugzeugabsturz verwüstete Land ruft es:
Tröstet!
Auch über die Rätsel menschlicher Not und über die Dunkelheiten und Ängste eines Menschenherzens ruft es:
Tröstet!
Alle, alles ist umfangen von diesem Ruf, der eine Wendung, um greifend und wohltuend, ansagt. Anfang und Ende umgreift er, Thema gibt er: Tröstet!, und noch einmal, damit niemand sagen kann, er habe es nicht gehört oder er habe sich verhört: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott! Darin und dadurch ist er unser Gott, dass er tröstet, am Anfang und am Ende und mittendrin auch, tröstet, »wie einen seine Mutter tröstet«.
Ach, wie gut das tut: dass zum Herzen geredet wird! Nicht geredet, um Kopf- und Gedankenspiele zu treiben; einmal nicht, um zu argumentieren und Gründe und Gegengründe zu erforschen und aufzuzählen gegen all die Not und Todesgebanntheit in der Welt; nicht, um sich zu verlieren im Nachgrübeln und Überdenken, sondern um es dahinein zu sagen und da zu hören, wo ja doch alles Schwere und Dunkle, alle Grübeleien Wurzeln schlagen wollen in uns, dorthinein, wo alles dumpf und hart uns manchmal umstricken will, dahinein, wohin es längst abgesunken ist aus dem Kopf und wo es Atmen und Denken und Tun und Lassen und Sehnen und Hoffen bestimmt: ins Herz! Dahinein, in die Mitte unserer Existenz hinein, von wo aus wir leben und sind: Tröstet! Redet freundlich!
Liebe Gemeinde: Adventsbotschaft fasst sich zusammen in diese Worte, nichts anderes wird gesagt, gepredigt, gerufen, geseufzt in diesen Adventswochen; alles fasst sich zusammen in diese Worte – vom geschlagenen, verängstigten, zukunftslosen Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft her bis hin zu den Rätseln und den Gefangenschaften der V ölker, der Knechtung und Verachtung von Rassen und Menschen, von Gruppen und Gesichtern, hin zu den fast nicht mehr zu überblickenden und erst gar nicht zu bewältigenden [24] Problemen und Fragen und Ängsten bei uns. Von Gott her seit alten Zeiten zu uns hin: das Wort des lebendigen, heiligen, ewigen Gottes, der kommt und hilft und nahe ist und durchträgt: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott!
Und umfangen ist das auch vom Ende her, das wir sogleich mit hören wollen, das erst den ganzen Ernst und die Schwere und die Bedeutsamkeit des Trostes ausmacht, damit niemand denke, es gehe mal wieder nur um die so wohlbekannte alljährliche christliche Weihnacht: Stimmungströstung, kurzfristig und oberflächlich, hinwegtäuschend über all die Kluften und Steilen und Abhänge des Lebens, an nichts heranreichend, alles nur überspielend und in silbrige Lamettafäden hüllend: Nein, mithören sollen wir das Ende, und vom Ende her sollen wir hören, was die Botschaft trägt und hebt und endgültig und zu einer macht, die allein noch und nur vom lebendigen Gott her kommt auf uns sterbliche, vergängliche Weltmenschen hin: Das Wort unseres Gottes aber bleibt in Ewigkeit!
Nicht wahr, so etwas braucht es, damit wir Christen es ja nicht vergessen; auch im Advent weht uns Osterluft, Auferstehungsgeist wind an: etwas, was gültig bleibt, was Bestand hat, was eben nicht aufgezehrt und aufgefressen und angenagt wird und nicht verdirbt in den Tiefen und Verliesen der müden Herzen und der schwermütigen Gedanken, die argwöhnen, und was nicht verschlissen wird im Lauf der Dinge, die uns zuraunen, ob das denn wirklich alles wahr sei, was da gesagt, verkündet, gepredigt wird in der Kirche unter und für uns. Da braucht es dies Tiefenwort, das Tiefenschärfe gibt nun in unser Leben und ins Leben und Vergehen der Welt und ins Leben und Treiben und Kämpfen und Verzweifeln der Völker, die gefangen sind und geknechtet werden von boshaften und todbringenden Mächten und ihren Helfershelfern. Dahinein braucht es Wahrheit von Gott, die sagt: Er kommt! Er umfängt uns von Anfang bis Ende! Seine Herrlichkeit soll offenbart werden allen miteinander …
Um diesen Gott geht es da in der Krippe, liebe Gemeinde, um diesen Gott da, der Jesus: »Gott rettet« heißt und der hört auf den schönen hebräischen Namen Immanuel: »Gott für uns, Gott mit uns«. Um den geht es, das ist der eine Name, der hinter der Botschaft des Propheten Jesaja schon steht, noch verborgen und nicht genannt, aber doch Triebkraft und Liebeswillen göttlichen Handelns von Anfang der Schöpfung an ist, und den wir Christen neu kennen und lieben und ehren und bezeugen und predigen dürfen: Jesus Christus, Gott für alle, der rettet. [25]
Und der allein bleibt. Ewig. Was heißt: unzählbar, unabsehbar lange für uns. Und weil unabsehbar lange für uns, deshalb auch unbeeinflussbar in seinem herrlichen, klaren Rettungswillen, frei in seiner umfassenden, niemanden ausscheidenden Liebe, herrscherlich entschlossen und nicht zu hindern. Dessen Werk kann niemand hindern, das er tut uns zu gut. Die Herrlichkeit dieses Herrn soll offenbart werden.
Und da wollen wir denn doch demütig und bescheiden bekennen: dass wir diesen Herrn und Gott nun nicht erwartet haben, ihn nun gerade nicht erwarten. Dass es uns längst nicht mehr aufreißt und hochreißt, in Bewegung versetzt, uns Christen, dass wir da sicherlich keine tiefen Täler auftragen und keine Berge abtragen würden, ihm den Weg zu bereiten auch zu unserem Nächsten hin und in die geschundene Menschheit hinein, dass wir ihn doch lieber kerzenhell und kaminwarm in unseren vier Herzenswänden einsperren, ein Exklusivgötzlein für unser angeschlagenes Seelchen, aber doch kein freier, hoher, allumfassender erbarmender Weltheiland. Nein, liebe Gemeinde, wir sind weithin angepasste Christen, wir sind eine Kirche, die müde und matt und gefangen und so oft heimlich und offen resigniert ist angesichts all der Ängste und des Unglaubens und der Torheiten und Frechheiten und Vergeblichkeiten und Krankheiten im eigenen und nächstliegenden Menschenleben. Krippenchristen, die den Herrn Jesus mit abgedroschenem Herzensstroh warm und liebreizend zudecken, damit er uns nicht hineintreibt in die kalte und herzlose und gefährliche Welt! Ist es nicht so, ihr Lieben, dass wir das eben bestenfalls noch mit dem Kopf hören, dass er der Weltheiland ist, und das im Kopf speichern für ein paar Augenblicke, dass aber alle anderen Welt und Menschenbilder uns viel mehr bedrängen und hilflos machen und ängstigen? Und dass wir unsere private Zukunft reduzieren auf die Rettung der Seele, aufs Durch- und Fortkommen im Beruf, auf Sorgen um Gesundheit und Zukunft im Alter, um Kinder und Enkelkinder noch – doch den Tröster nicht rufen hören: »Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit!«?
Dass Advent und Weihnachten nun doch jährlich wiederkehrende und abgedroschene, von Mal zu Mal aufgeblasene Ereignisse sind, wo die Pfarrer ins Hetzen und Herumreden und Herumandachten und also an das Ende ihrer Kräfte und völlig aus der Ruhe geraten und die Christen und Menschen in unserem Land etwas gefühlvoll und geschäftig werden – und doch wendet das keine Not, bringt keine bleibende Tröstung, schafft kein währendes Licht, was wir tun und spenden [26] und sagen und predigen – ist es nicht so? Und: Ist das nicht ein großes, hartes, geheimes Gericht über sein Volk, seine Kirche, dass wir diesen berge- und tälerversetzenden Gott, den Schöpfer und Erhalter alles Lebens, vergessen, diesen völker- und herrscherstürzenden, also: diesen wahrhaft und einzigen und einzigartigen, Natur und Geschichte revolutionierenden und seiner Gerechtigkeit zuführenden Gott so klein, so unscheinbar, so armselig, so verachtet gelassen und so beiseite geschoben haben?
Und nun, gegen allen Augenschein und gegen alle Herzensmüdigkeit und Gedankenschwere, gegen unser Gemüt und gegen die Botschaften der Welt gilt es:
Euer Gott kommt!
Noch hat man damals nichts gesehen. Da wird uns nur dies im Exil dahindämmernde und verzagende Volk Israel vor zweieinhalbtausend Jahren zum Gleichnis, steht es neben uns, der Kirche. Gott sei Dank, zum Gleichnis des immer wieder und immer neu gültigen Gottesgeschehens. Ja, dadurch zum Gleichnis, weil sich alles geheilt, erklärt, aufgeklärt hat, was damals noch im Dunkel und in der Verdeckung vieldeutiger Ereignisse blieb, was aber im Schauen und Deuten und Entdecken erkannt und bekannt wurde von Israel und erkannt und bekannt werden darf von uns, im Glauben nun sichtbar und klar werden darf. Gleichnis: des Volkes Verbitterung und Mutlosigkeit all dem von Gott Berichteten und Gepredigten und Erzählten gegenüber und seinen Boten gegenüber: dass ER der Schöpfer und der Lenker und Herr der Geschichte ist, dass, wie man hört, die Herren dieser Welt gehen müssten, dass aber unser Herr komme, dass das alles zwar gesagt und gehört wurde, aber nicht geglaubt, nicht zum Trost wurde, nicht in die Herzen derer drang, die da saßen im Schatten des Todes und in der Lähmung innerer und äußerer Gefangenschaft. Und die keine Hoffnung mehr zu haben wagten!
Und dahinein klingt dieses Aufbruchsignal! Ganz von außen, in keines Menschen Herz wurde es ersonnen, von keinem Menschenhirn wurde es erdacht, auch gar nicht mehr erhofft: das Signal der Rettung und des Trostes.
Gewiß kennen einige von Ihnen die Beethoven-Oper Fidelio. Da ist der Florestan im Kerker unschuldig gefangen, von einem ungerechten und düsteren und gemeinen Tyrannen, dem er die Wahrheit sagte und der ihn aus dem Weg räumen ließ und nun dort unten ermorden will, heimlich und im Dunkel. Florestans Frau, als Kerkermeistergehilfe Fidelio – was heißt: die Treue – verkleidet, findet ihren Mann am Ende seiner Kräfte, todgeweiht, soll gar helfen, ihm das Mördergrab zu graben, kann ihm nur noch das Totenlied vielleicht singen und seufzen. Weiß zwar von einer vielleicht nahenden, rechtzeitig eintreffenden Befreiung, aber der soll durch schnellen und heimlichen Mord vorgebaut werden; von einer Befreiung, wie die Menschen zu allen Zeiten es ahnten und wie es immer wieder ins Bewusstsein einzelner und von Gruppen heraufstieg: dass es doch eine Wende, eine Rettung aus tödlicher ungerechter Knechtschaft geben müsse und aus Folter und Haß und Todesverfolgung durch ungerechte, wahnhafte Herrscher
– Namen und Gestalten müssen wir ja nun wahrlich nicht nennen, solche kleinen und großen machtbesessenen Blutherrscher geistern durch die Menschengeschichte und lassen zigtausende Schlachtopfer sich bringen und ihrem blutigen besessenen Machtwahn. Und da hinein, in den Kerker des Menschen Florestan, da tönt plötzlich von außen das Signal, ein helles Trompetensignal. Die Musik hat den Atem angehalten, alles zittert vor dem erhobenen Mörderarm und dem Todesstoß – da tönt es, laut und klar, von außen: Rettung ist da, kommt, von außen bricht sie herein in den Kerker: »Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Seinem Angesichte kam euch die Rettung her!« Tröstet, tröstet mein Volk, redet zu Jerusalem freundlich: ihre Kerkerschaft hat ein Ende.
Liebe Gemeinde: dieses Trompetensignal des Beethoven-Fidelio, dieses Signal der unerschütterlichen Treue und des unumstößlichen Rettungswillens Gottes, das anzeigt, meldet, rufen lässt: der gerechte und wahre Herr kommt, den ungerechten, tyrannischen, todesrünstigen Statthalter zu strafen und die Gekerkerten zu befreien: dieses Signal von außen hat Ernst Bloch, der Philosoph und Rettungssehnsüchtige, einmal das erschütterndste und hellste und deutlichste Signal der Musik genannt. Und wie anders kann es einmünden dann im himmelhoch jauchzenden Freudenjubelgesang der Geretteten: »Oh, du namenlose Freude!«
Ja, ihr Lieben, das erschütterndste und klarste und hellste Signal
unsres Lebens und des Lebens dieser Menschen- und Völker- und aller Kreaturwelt aber ist dieser Ruf am Anfang des Advents Jesu Christi: Tröstet, tröstet mein Volk! Hinwegräumen der Hindernisse, der Wüsten und Berge, der Schluchten und Abhänge, der Grate und Riffe: das geschieht für ihn und uns. Nicht durch uns! Für uns!
Ach, wie sollten wir auch räumen, begradigen, ab- und auftragen, Wege bauen können in unserer Zagheit und Zweifellage, in unserer [28] Müdigkeit und Armseligkeit? Aber Er ruft, ja: Gott arbeitet: »Mir hast du Mühe gemacht, mit deinen Sünden«, aber aus lauter Liebe tritt er selber ein: »Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht!« Welch ein Adventsgott: 0, du namenlose Freude!
Seelenschutt und Lebensangst, Schöpfungsseufzer und Kreatur schrei, Jammer und Not: was haben wir für einen Gott, der da herein bricht und hilft, Wendung und Rettung trompeten und durchführen lässt! Ja, jetzt wird es deutlich, das Ende, das wir erwarten, und das Ende, das uns umfängt, das er bringt: Ja, ja, alles vergeht, und die Katastrophen und das Erdbeben in Armenien und der Flugzeugabsturz in Remscheid und die Kriege und Morde im Iran und in Afghanistan, die erschütternden Folter- und Mord- und Todesnachrichten sind die Botschaften der Herrscher dieser Welt, alle wissen es, schieben es beiseite, aber bekommen es unübersehbar wieder und wieder vor Augen geführt: Alles vergeht, alles verbrennt unter dem Gluthauch des Wüstenwindes Gottes.
Alles Fleisch ist wie Gras! Die frühlingsblühende, blumenfeldweite Landschaft Galiläas steht als Bild, über die dann im Sommer der heiße Wüstenwind weht, alles verbrannt, kahl und braun und steinig zurück lassend: so, so ist es mit dem Leben, so ist es mit den Mächtigen, so ist es mit denen, die immerwährend zu blühen scheinen in ihrer eigenen Kraft und Macht.
Jedes hat sein Ende, die irdische Herrlichkeit und auch die blühendste Not: weil Er kommt und weil nur eines gilt, bleibt und hält und den heißesten tödlichen Sturm übersteht: Sein Wort aber bleibt ewiglich.
Was aber, liebe Gemeinde, sagt sein Wort? Nicht billig ist sein Trost, nicht dies kümmerliche Bildersprüchlein an der Wand: »Immer, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht lein her.« Nein! Nicht dies kindliche »Heile, heile Gänschen, es wird bald wieder gut!« 0, wie gottlos und hilflos sind solche Sprüchlein und wie trostlos solche Pflästerlein, wenn die Bilderwände einstürzen und der Todesgluthauch weht! Sind allesamt doch nicht besser als Drogen und Alkohol und Vergessenheitsspender für kurzfristiges Leben herüberretten in einen neuen Tag. Oh nein: hier wird aufgerüttelt, hier wird nicht vergessen, sondern abgeschafft; hier wird nicht vertröstet, sondern Neues, Gerechtigkeit, geschaffen durch den Lebenswillen Gottes; hier erscheint der wahre und gerechte und heilbringende [29] Erlöser: »Nun komm, der Heiden Heiland!« Der Heiland: der macht sich auf und provoziert diesen Ruf, diesen Trost, diese weltändernde Bahn schafft er.
Und wir Christen, seine Gemeinde? Was tun wir? Zuerst, zunächst und immer noch: hören, aufmerken, es uns vom Himmel hoch singen und sagen lassen, es als gute, neue Mär gelten lassen für uns: »Die Herrlichkeit unseres Heilandes soll noch offenbar werden über aller Welt!«
Keiner hat das damals sehen können. Im Himmel, bei Gott, war die Rettung vorbereitet für sein Volk, waren die Rettungspläne, die Wegebegradigungs- und Aufbau- und Abbaupläne fertig und genehmigt, und das Arbeitspersonal war berufen: der Perserkönig Kyros – der sich für den mächtigsten und alleinbestimmenden Herrscher, Eroberer und Sieger von Babylon hielt: nur ein Werkzeug, ein Aus führender im Architekturplan Gottes. Wie alle die Mächtigen und Regenten dieser Welt: so müsst ihr sie sehen, die gernegroßen Kleinen und die kindischen Großen: Erfüllungsgehilfen Gottes in seinem Rettungs- und Hilfsplan! Alles ist vorbereitet, das Signal abgesprochen, das wir hören dürfen: den hellen Trompetenstoß: Tröstet, tröstet mein Volk – damit beginnt es und geht es fort unaufhaltsam: »Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen, zu seinem Zweck und Ziel!«
Was sie damals hörten, war nur das Signal, nur der Ruf, eben: die Predigt, die Freudenbotschaft ins Herz hinein, das in Worten gemalte Befreiungsgemälde von der königlichen Prachtstraße der Rettung und Führung ins Leben. Und es ging in Erfüllung. Sie haben es gesehen, erkannt, wiedererkannt: Gott lässt seine Welt nicht, seine Schöpfung nicht, seine Menschen nicht, sein Volk Israel nicht, seine Kirche nicht, er lässt uns nicht, dich auch nicht, sondern beugt sich zu dir herunter und sagt dir hinein ins Herz, lässt dir freundlich mitteilen in dein Leben hinein, in die Kerker deiner Angst oder deiner Selbstzufriedenheit oder deiner Schuld, deiner selbstgemachten und geglaubten Gottesferne: Die Knechtschaft hat ein Ende, ihr gehört dem Heiland, ihr seid Menschen Gottes!
Advent, liebe Gemeinde: Gott kommt zu dir, dir das anzusagen;
Advent: du kommst zu Gott, dir das sagen zu lassen und dich zu freuen: 0, du namenlose Freude. Das ist seine Gemeinde: die sich das sagen lässt und nun der Freude einen Namen gibt, damit der hineingerufen werde in die dunkelsten Menschenecken und erleuchtetsten [30] Menschenköpfe: Jesus, Jesus von Nazareth, »zu Bethlehem geboren, in der Stadt Davids«. Und dann, da du nun um Namen, Zeit und Ort dieses Retters weißt, und das alles in deinem Herzen bewegt hast, dann gehst du hin, liebe Gemeinde, und verkündigst, erzählst, berichtest von dem gekommenen Gottessohn. Und wirst drüber zur Freudenbotin: ein anderes Amt, eine andere Aufgabe, einen anderen, wie man so sagt, Sinn, hat unser Leben nun nicht mehr, das genügt: zum ersten nach dem Trost des Reiches Gottes zu trachten …
Dann reden wir zu den anderen tröstlich und gewiss, und der Nächste wird hineingeholt in die Gottesbewegung, auf den Rettungsweg, auf dem ihm die Herrlichkeit des Herrn entgegenkommt, sein Leben neu zu machen, erstrahlen zu lassen im Glanz, in der Pracht nun nicht mehr des vergänglichen Fleisches, sondern allein noch Seines Wortes. Was wir zu sagen haben und nach welcher Richtschnur wir nun adventlich zu leben und in diese Welt hineinzusehen und in ihr zu wirken haben, das ist uns vom Propheten längst vorgesagt, und jetzt· habt ihr es auch wieder gehört:
Alles Fleisch ist Gras; und all seine Pracht ist wie eine Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Amen.
Rudolf Landau 11.12.1988 3.Advent in Neunkirchen am Brand
Aus seiner Predigtsammlung. „Gottes Sohn ist kommen“ Predigten und Bilder zur Weihnacht. Herausgeber Rudolf Landau, Stuttgart 1994, S.24-30
„Unsere Kirche bleibt im Dorf!“ – Nach Renovierungsarbeiten haben die Günthersbühler ihre Kirche wieder

Es war ein frohes Fest! Viele Kirchenvorsteher, Stadträte, sogar Bürgermeister Lang und Dekan Tobias Schäfer waren gekommen, um zusammen mit den Günthersbühler Bewohner*innen und vielen Gästen die Wiedereinweihung der Kirche zu feiern.
Nur 3 Monate hatten die Renovierungsarbeiten unter der Regie von Architekt KlausThiemann aus Hersbruck gedauert. In dieser Zeit wurde ein einsturzgefährdeter Stützbogen gesichert, die Decke stabilisiert, Risse verputzt, der vom Holzbock befallene Dachstuhl verbessert und begast, Wände, Fenster und Türen gestrichen, die Bänke mit neuen Polstern versehen und – die Krönung – eine neue elektronische Orgel eingebaut. Letztere hat der Freundeskreis der Laufer Kirchenmusik gespendet. Nun strahlt die Kirche in neuem Glanz und steht wieder für Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Feste offen.
Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne das fleißige Engagement der Günthersbühler/Nuschelberger Gemeindeglieder, allen voran Kirchenvorsteherin Veronika Strittmatter. Unermüdlich hatte sie sich für die Renovierung eingesetzt und, als es so weit war, nicht nur selbst fleißig Hand angelegt, sondern auch andere motiviert und koordiniert. So wurde in Eigenleistung die Kirche aus- und eingeräumt, geputzt, ein neuer Zaun erstellt, der Platz vor der Kirche ge“kärchert“ und vieles mehr. Doch auch eine Spendenaktion wurde auf die Beine gestellt, ein Flyer erstellt und persönlich an alle Haushalte in Günthersbühl getragen.
In ihrer Predigt ging Pfarrerin Lisa Nikol-Eryazici darauf ein, wie wichtig und identitätsstiftend eine Kirche im Ort ist: Für die, die regelmäßig die Gottesdienste besuchen und hier Gemeinschaft, Orientierung und Trost finden, aber auch für die Menschen, die an wichtigen Übergängen des Lebens sich des Segens und der Begleitung Gottes versichern möchten, bei der Taufe, Konfirmation, Trauung oder am Ende des Lebens. Und sogar für diejenigen, die nie aktiv in die Kirche gehen, sei die Kirche vor Ort mit ihrer Ausstrahlung, den Glocken und der Präsenz Heimat und ein Stück Geborgenheit, so die Pfarrerin. Die jetzige Generation habe nun ihren Anteil am Erhalt geleistet, doch bald läge es in den Händen der Jungen.
Pfarrer Hanstein erläuterte im Anschluss die verschiedenen Renovierungsschritte und zeigte sich zufrieden, dass sowohl der zeitliche Rahmen als auch die angesetzten Kosten von 90.000 Euro unterschritten wurden. Er dankte der Stadt Lauf und dem anwesenden Bürgermeister Lang sowie den Stadträten für den freiwilligen Zuschuss in Höhe von 10%.
Dekan Schäfer würdigte in seinem Grußwort das Engagement der Günthersbühler und betonte, dass er es sehr begrüßt hätte, wenn im Zuge der Renovierungsarbeiten auch ein barrierefreier Zugang geschaffen worden wäre; leider sei der von Seiten der Landeskirche aus Kosten- und bautechnischen Gründen gestrichen worden. Wir brauchen aber, so der Dekan, für unsere Kirchen barrierefreie Zugänge, auch im übertragenen Sinn, Zugänge zu Kirche und Gemeinde, die jeder aus seiner Lebenssituation leicht finden und betreten könne.
Pünktlich zum Gottesdienstende hatte der Regen aufgehört, und so stand dem anschließenden Fest nichts im Wege. Viele Ehrenamtliche hatten ein wunderbares Buffet hergerichtet, Bratwurstgeruch und die Klänge des EC-Posaunenchors erfüllten die Umgebung, so dass die Gäste noch lange bei Gesprächen und gutem Essen zusammenblieben.
Im nächsten Jahr feiert Günthersbühl sein 70jähriges Jubiläum.
Pfingstpredigt 2021 von Pfr. Jan-Peter Hanstein, Johanniskirche Lauf
Steine und Geister

1 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. 2 Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. 3 Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! – und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel 4 und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde.
5 Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten.
6 Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun.
7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe!
8 So zerstreute sie der HERR von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen.
9 Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde.
Gen 11,1-9
(wie schnell getippt, gesprochen ist nicht geschrieben …)
Liebe Gemeinde
Letztes Jahr habe ich gedacht: Corona ist Anti-Pfingsten! Die Menschen bleiben möglichst zu Hause, bewegen sich vorsichtig in der Öffentlichkeit. Die Grenzen der Länder sind dicht, der Austausch und das gegenseitige Besuchen wurde angehalten. Nicht der Geist verbreitet sich weltweit, sondern das COVID19 Virus mit rasender Geschwindigkeit.
Heute hören wir die Geschichte vom Turmbau zu Babel auch als Antigeschichte, oder?
1) Der Turmbau von Babel geht um die Unterscheidung der Geister: Den Einen Geistes Gottes, von den anderen Geistern.
2) Der Turmbau von Babel ist keine Fabel, kein Märchen, keine historische Erinnerung sondern ein Gleichnis, atmet denselben Geist prophetischer Erzählungen wie die Gleichnisse Jesu.
3) Die heutige Predigt ist Teil 1: Der eine Geist. Morgen am Pfingstmontag Teil 2 – werde ich in der katholischen Kirche St.Otto die Fortsetzung predigen: die vielen Gaben des einen Geistes.
1. Blick in die Schreibwerkstatt
Wenn es nur um die Unterscheidung von Stein und Geist ginge wäre es einfach. Wenn der andere Geist leicht erkennbar wäre, wäre es einfach. Da schauen wir den SchreiberInnen der Bibel einmal in die Werkstatt.
a) Der Schlüssel ist, dass sie den Ort Babylon nennen. Damit geben sie das Signal: Wir die wir schreiben, wir sind Teil der Arbeiter an diesem Turm, wir Juden, die verschleppt worden sind aus Israel. Wir haben aufbegehrt gegen den Einheitsstaat Babylon, wollten mit Ägypten den Aufstand wagen gegen die gnadenloser Unterdrücker und sind schrecklich gescheitert. Jerusalem zerstört, die Führungsschicht als Geiseln in Babylon.
b) Das neubabylonische Reich hatte nicht dazugelernt. Sie versuchten ein Reich zu bilden mit einer Einheitskultur, einer Sprache, einer Herrschaft, einer Religion. Später die Perser wollten es besser machen, zerstören das berühmte Heiligtum in Babylon und riefen ein Zeitalter der Toleranz unter ihrer Führung aus. Die Griechen unter Alexander wollten dagegen wieder dominieren. Alexander versuchte sogar diesen Turm wieder aufzubauen, aber scheiterte durch seinen frühen Tod.
Die Geschichte vom Turmbau zu Babel ist also subversiv – und prophetisch. Denn zu der Zeit des babylonischen Exils galt dieser Turm schon als Weltwunder. 100m hoch auf einer Grundfläche von ein Hektar. Klar wurde daran immer gebaut, wie heute am Kölner Dom. Aber das Heiligtum war in Betrieb, die Dominanz durch überlegene Baukultur jederzeit vorführbar.
Wie sieht die Analyse aus?
2. Die Noachiten
Das Volk, das den Turm baut, sind in der Geschichte die unmittelbaren Nachkommen Noahs! Das waren auch „Materialisten“, die durch den berühmten Schiffbau der Arche überlebt haben. Übrigens mit Abmessungen und Verhältnissen, die dem Tempel in Jerusalem glichen. Klar – ein Volk der Macher und Techniker. Wenn sie ein Heiligtum, bauen, dann zu ihrem eigene Ruhm – Macht und schiere Größe. Und zur Sicherheit. Keine Flut mehr soll den Turm vernichten? Und auch heute noch haben diese Noachiten Nachfahren: China mit seinem wahnsinnigen Projekt der chinesischen Mauer, die neureichen Staaten in Arabien und Asien, deren Türme nun bei über 500m angelangt sind. Es wurde ausgerechnet, dass der Turm von Babel umgerechnet 5mrd€ kosten würde – aber um in den Himmel zu kommen, waren ganz andere Beträge notwendig: der Wettlauf auf den Mond und die Raumfahrt kostete Billionen und Gagarin konnte nach seinem ersten Flug um die Erde beiläufig berichten. Gott habe ich dort oben nicht gesehen …
Das sind die Nachkommen Noahs, die diesen Turm bauen in Einheitsstaaten und Ideologien. Das Judentum konnte das schon immer nüchtern sehen. Durch die Mauern hindurch – prophetisch: diese Türme werden verlassen, die Projekte nie abgeschlossen, aber hinter dem schönen Schein stehen die Toten und Unterdrückten. Wie hinter dem unvollendeten Reichsparteitagsgelände das KZ Hersbruck mit tausenden Toten mit in einer wunderschönen Landschaft, in der wir gerne herumwandern. Und natürlich hatte Hitler mit seiner Megastadt GERMANIA den Traum eine 10 mal größere Kuppel wie den Petersdom zu bauen.
3. Das Gericht Gottes ist die Unterscheidung … Geist Gottes. Geist der Menschen.
So einfach.
Die Vielfalt der Kulturen ist uns nun gegeben. Was geschieht nun an Pfingsten? Die Geburt der einen wahren richtigen Weltreligion des Christentums – der einen wahren Kirche?
Genau zu Pfingsten erscheint eine Rezension in den Nürnberger Nachrichten über die Gottesherrschaft der deutschen Missionare in Neuguinea und ihre Anfälligkeit für den Nationalsozialismus. Ein kleiner Hinweis – wie weit die Macht des Christentums reichte und reicht.
Die Kirche war oft genug ein Projekt wie der Turmbau zu Babel. Die Wahrheit der Religion sollte sich an Macht Größe und Erfolg zeigen. Die größeren Kirchtürme, die eindrucksvolleren Kunstwerke, beeindruckend und einschüchternd mit dem Verbund von Königen von Gottes Gnaden und ihren Soldaten.
An diesen Weltkirchen und ihrem Wettlauf um die Weltmacht zwischen Westen und Osten, schließlich Katholisch und Evangelisch und dem Islam wird das Gericht Gottes vollzogen. Sie verstehen sich nicht und sie kämpfen gegeneinander und töten sich. Projekt Babel muss scheitern.
Die Unterscheidung der Geister ist eine unglaublich mächtige und schwierige Angelegenheit. Wir danken diese Geschichte den Juden und schon an so einer kleinen Geschichte von 10 Versen sehen wir, wie wichtig die Juden sind. Sie sind das Salz in der Suppe. Die bilden die Differenz. Eine wahre Kirche ohne Juden kann es nicht geben. Und der aufkommende Judenhass in der Corona-Krise und um die Kämpfe in Israel zeigen, dass wieder etwas in eine grundfalsche Richtung läuft.
Im Umgang mit dem Impfstoff gegen Corona wird sich auch wieder der Geist zeigen:
Der menschliche Geist, der mit der Macht über den Impfstoff andere ausbeutet und unterdrückt, wie Russland, die überall ihren Impfstoff Sputnik anpreisen und verkaufen für gute Devisen und Einfluss, aber nicht daran denken, ihr eigenes Volk zu schützen, aber auch der Egoismus USA‘s, die nach Exportverboten und Selbstbedienung großzügig die Freigabe der Patente fordern. Immerhin konnte sich die EU auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Aber entscheiden wird sich der Kampf gegen das Virus in der übrigen Welt. Wenn wir da nicht genauso alle Kräfte und unser Vermögen uneigennützig einsetzen, wird auch dieser Turm zusammenbrechen. Das Impfprogramm kann im Geist Gottes betrieben werden – kleinteilig für alle, oder im Geist der Menschen: großspurig als Allmacht weniger, die auf die Gebote Gottes spucken und sagen werden wie Mose: Wir haben das Wasser aus dem Fels geschlagen … Es geht nicht um eine Menschheit, sondern deine Menschheit! Herr!
4. Prophetisch, richtend. Unterscheidend: das dritte Pfingsten …
Der Geist Jesu. Wie in seinem Gleichnis vom eigensüchtigen Kornbauern, dem Gott sagt: Du Narr! Heute wird deine Seele von dir gefordert werden.
So fährt Gott hinab, um das Türmchen der Weltherrschaft überhaupt sehen zu können. Feiner Humor der biblischen Erzähler. Ernste Worte:
Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun.
Die Strafe Gottes ist eher Barmherzigkeit. Diese Werk der Menschen soll nicht vollendet werden in seiner Maßlosigkeit und Zerstörung, der Grausamkeit und Dummheit.
Wir kommen nicht darum, das Gericht Gottes zu sehen, das über solchen Projekten vollzogen wird. Die Diversität und Vielfalt der Sprachen und damit der Völker ist ein weiterer Eingriff Gottes in die Welt der Menschen, raffinierter und nachhaltiger als die Sintflut. Eine Wirkung des Geistes Gottes … Gott lernt dazu. Die Menschen sollen sich nicht mehr ohne weiteres verstehen und sich einig sein – vor allem nicht um gegen Gott wie Gott sein zu wollen. Denn erzählt wird ja von den Noachiten, die leider auch Kinder Adam und Evas, die dafür anfällig waren und Nachfahren Kains, dem Brudermörder, der nicht zufällig als Stadtgründer berühmt geworden ist.
Gott fuhr hernieder heißt es.
Und dann: . 7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe!
8 So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. 9 Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.
Ein zweites Mal fährt hernieder der Geist Gottes, nach dem Wehen des Geistes bei der Schöpfung. Eine Art urzeitliches Pfingsten. Aber der Geist Gottes, der über solche Menschen ausgeschüttet wird, bewirkt zuerst Zerstreuung, Verteilung über die ganze Welt. Eine erste Mission – sie sollen über die ganze Erde verteilt leben.
Pfingsten: die Sprache ist verwirrt. Babelbabbel. Balal. Wortspiele. Für die jüdischen Erzähler ein Segen. Inder Vielfalt können sie untertauchen, überleben. Länger als alle anderen Völker und Sprachen. Festgeschrieben durch das Wort Gottes und den Bund.
Und das dritte Pfingsten, lange vorhergesagt. Da wird wieder der Geist Gottes ausgeschüttet und bewirkt die Predigt vom Geist Christi, da versteht sie jeder in seiner Sprache. Aber das Wunder überzeugt nicht alle. Auch hier wieder Spaltungen, Trennungen. Keine Beginn einer neuen totalen Religion des Geistes. Nur eine Übersetzung. Die Botschaft muss gehört werden. Verstehen alleine reicht nicht.
Und so bleibt das große Fest Pfingsten auch „kleinteilig“. Demütig. Aber doch so groß, dass ich 2 Predigten brauche 😊 … über die Konsequenzen und die Gaben des Geistes Gottes dann morgen in St. Otto.
AMEN
Ein Tag mit Gott – Film der EJ Lauf
Begleite uns durch den Tag mit Aufstehen, Schule, Mittagessen, Freunde treffen und Jugendgruppe. Was an dem Tag passiert, das entscheidest du! Am Ende jedes Videos musst du eine Entscheidung treffen, was als nächstes passieren soll. Starte jetzt das erste Video mit diesem Link: www.ej-lauf.de/tag

Paulus in Athen, Apg 17. Predigt zum Nachlesen von Pfarrer Jan-Peter Hanstein im Livestreamgottesdienst St. Jakob an Jubilate 25.4.2021
Liebe Gemeinde,
Paulus in Athen…
So beginnt kein Witz, sondern eine ernsthafte Erzählung von Lukas in seiner Apostelgeschichte.
Paulus in Athen – ca. 500 Jahre nach Sokrates Tod. Ein halbes Jahrtausend. Genauso lang wie Luther 1521 in Worms, als er dem Kaiser ins Angesicht gesagt haben soll: Hier stehe ich und kann nicht anders.

Athen zu Pauli Zeiten ist in einem ähnlichem Zustand wie Wittenberg heute. Längst hat es die politische und geistige Bedeutung verloren. Noch vor kurzem bröckelte es überall. In der Schloßkirche, in der Universität, die einmal die größte Europas gewesen ist.
Ein paar Lutherfanatiker verwirrten verirrte Touristen aus den lutherischen Missionsländern, die sich fragten, was um Gotts Willen mit diesem Ort geschehen ist: das Gedenken an die Reformation wird für Touristen aufgehübscht, ohne dass nur irgendeiner noch weiß, dass das mal eine Sache auf Leben und Tod gewesen ist.
Paulus also in diesem musealen bröckelnden Athen, zurückgeblieben hinter den Weltstädten Ephesus und Korinth mit ein paar verwirrten Philosophen. Stoiker und Epikureer, schreibt Lukas. Hier geht es um Weltanschauungen – die Stoiker sind sozusagen die damaligen Veganer, Spaßbremsen, die mit nichts ihren Körper verunreinigen wollen, während die Epikureer die Grillfraktion* sind: die Steaks können gar nicht groß genug sein und das Bier muss in Strömen fließen bei jedem bisschen Sonnenschein.
Und bei diesen Pseudophilosophen beliebiger Couleur jetzt also Paulus – das wird nicht lustig, ahnen wir. Paulus ist ja ein Aufrührer, einer wo auch immer er auftaucht, die öffentliche Ordnung gestört hat und sogar den Frieden der Religionen mit seinem heiligen Ernst. Er wird sogar eingeladen von den Akademikern auf dem Forum, dem Areopag. Sie sind gierig nach Neuem, aber vergessen das Neue schon über dem nächsten Trend, der einen nach dem anderen jagt.
Hören und lesen wir Paulus und ich zeige euch dabei gleichzeitig das neueste Glasfenster aus der Johanniskirche von Andreas Felger. Wenn ihr nicht in die Kirche kommen könnt, kommt die Kirche eben zu euch …
Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben:
Dem unbekannten Gott.
Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt.
Apg 17,22-23
Wir ahnen es, eine große Rede wird folgen. Paulus hat ja diesen nachgeborenen Philosophen unglaublich voraus, so viel mehr als sie ahnen:
Paulus ist weitgereist – er kennt die griechische Welt genauso wie die jüdische Diaspora, er ist römischer Staatsbürger und als Pharisäer Christ geworden. In ihm ist alles angelegt: die leidvolle Erfahrung einer Flüchtlingsfamilie – seine Familie wurde bei der römischen Eroberung von Galilea vertrieben. Sie fanden neuen Heimat in der Diaspora, in der kleinasiatischen griechischen Kolonie Tarsus, mit den gleichen Göttern, Stadien, Akademien wie in Athen, nur alles eine Nummer kleiner. Paulus heißt eigentlich “Scha’ul = Saul”. Nach diesem unglücklichen König Saul haben nur fromme Juden ihre Kinder genannt – die den hebräischen Namen liebten: Scha’ul, der Erwünschte. Dieser Saulus wurde schon früh auf griechisch “der Kleine =Paulus“ genannt, denn er war klein von Gestalt. Er war ein Wunschkind, lernte zuerst Zeltmacher und durfte dann studieren mit dem neu erworbenen Reichtum der Eltern – ähnlich wie Luther, dessen Vater sich vom Bergmann wie auch immer zum Bergwerkbesitzer emporgearbeitet hatte. Jede Stufe war für den jungen Martin ein neues Bildungsabenteuer – bis hin zum Lehrstuhl als Professor. Paulus studierte am Ende in Jerusalem und hasste fanatisch die Christen und verfolgte sie. Bis er bekannterweise auf wundersame Christ geworden war. In Antiochien, der drittgrößten Stadt der damaligen Welt, lernte und arbeitete er 14 Jahre in der christlichen Gemeinde mit, bis sie ihn und Barnabas in die Welt mit Segen und Auftrag in die Welt schickten.

Aber jetzt seht, wie Felger Paulus gestaltet. Sieht er nicht aus wie ein Mönch, eben wie dieser kleine Mönch aus Wittenberg? Er trägt eine weißgraue Kutte mit Kapuze und es scheint mir, als hätte er diese ausrasierte Tonsur, diese altmachende Halbglatze der Mönche, die MANN eigentlich erst im fortgeschrittenen Alter von allein bekommt … Felger sieht also Luther in der Tradition des Paulus. Oder umgekehrt 🙂 Er zeigt an diesem Altar vorbei nach oben. Der Altar ist zweigeteilt.
Unten grau griechisch mit der Aufschrift AGNOSTO THEO.
Oben aus Lehmsteinen wie ein Opferaltar. Da oben links – glaube ich zu erkennen – steht auf Hebräisch Ki. Das universale hebräische Fragewort: Wer, wenn, wie, was – ist Ki. Paulus sagt: Ihr Griechen huldigt dem unbekannten Gott. Ihr jüdischen Brüder – dem rätselhaften Stammesgott, dessen Namen niemand aussprechen soll. Eure Altäre sehen aus wie Grabsteine, auf die ihr auch noch andere Steinchen legt zum Gedenken. Aber wo ist euer lebendiger Glaube? Und mit dem Selbstanspruch des ausgesandten und beauftragten Völkerapostels sagt Paulus:
“Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt.”
Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts.
Apg 17, 24-28
Paulus kennt seine Griechen. Ihre rationalen Zweifel an der Götterwelt. Ihre Vorliebe für den Logos, die Vernunft gegenüber einer unübersichtlichen und als unlogisch ja unmoralisch empfunden Götterwelt. Musste nicht Sokrates an dieser Stelle den Giftbecher trinken, weil er mit seinem Denken als Gotteslästerer verurteilt worden war, der das Wahre dem Schönen und das Eine dem vielfältigen Schein vorgezogen hatte?

Paulus zeigt auf dem Bild von Felger vorbei, auf die himmlischen Kräfte, ganz in weiß mit diesem einen vollkommenen Kreis, von dem alles ausgeht…
Er knüpft geradezu synkretistisch an, an diesem unbekannten Gott, an der Sehnsucht der Griechen, den Ursprung zu ergründen, den Beginn der Naturwissenschaften, wie alles entstanden ist aus einem Prinzip, in den Anfängen. Gottes des Himmels und der Erden. [NB: Schlimm, dass der Spitzbogen auf den Postkarten unserer Kirchengemeinde von dem Fenster abgeschnitten wurde, war halt nicht rechteckig genug … aber ohne diesem lichten Himmel verstehen wir nix in der biblizistisch gedeuteten Geschichte von dem gebildeten Lukas. Ich habe hunderte IKarten wegwerfen lassen …]
Und die Griechen bisher nicken verständnisvoll. Klar – es kann nur einen Gott geben. Warum das ganze Durcheinander von Zeus und seinen Halbgötzen. Lasst uns schon aus Vernunft an einen Gott glauben, der diesen ganzen Pantheon von Göttern wie Marionetten bedient. Eine Wahrheit, eine Kraft, ein Geist, der in allem wirkt und der nicht in irrationalen Opferkulten und wahnsinnig aufwendigen Tempeln und Kirchen sich aufhält, sondern in der freien Luft der Gedanken sich bewegt. Gut spricht der Kleine, denken sie bis hierher. Wir sind göttlich ….
Und Paulus fährt fort
Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber, gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden ihren Sinn ändern.
Apg 17,28-30
Jetzt bindet Paulus oder Lukas seinen rhetorischen Sack langsam zu! Die Zeit der Unwissenheit ist zu Ende gegangen. Die Aufklärung ist da. Aber es bleibt nicht Wissen allein, sondern auch eine Lebensänderung, eine Sinnesänderung METANOIA , eine Umkehr wird kommen. Und es wird den Sophisten etwas mulmig. Was kommt da konkret auf uns zu? Was wird er für diese Erkenntnis verlangen? Welche Konsequenzen hat das? Und wir ahnen – mit Logik hat das nichts mehr zu tun, sondern mit Glauben.
Die Kraft, in unserem Leben etwas zu ändern, ist noch niemals aus der Rationalität gekommen. Sondern aus Liebe oder Mitleid.
Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.
Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten; die andern aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiter hören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig; unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.
Apg 17,31-34
Ihr Lieben. Paulus in Athen. Luther in Worms. So beginnt kein Treppenwitz der Geschichte. Sondern es geht um Leben und Tod. So ernst heute?
Entschuldigt mich. Ich hätte euch lieber wie so einige heute aus Ratlosigkeit von der schönen farbigen Sonne heute morgen gepredigt. Hätte euch erzählt von den Kirschblüten vor meinem Fenster. Den Narzissen im Garten und in den Parks. Von der wunderbaren Kraft des Frühlings, die jedes Jahr neu uns trunken macht und seltsame Dinge mit den Verliebten anstellt. Der Sonntag heißt doch JUBILATE. Jubelt! Preiset! Singt!!
Und doch bleibt mir angesichts der Situation, in der sich unsere Welt befindet, dieser Jubel im Hals stecken.
Aber jetzt geht es um das Gericht, die Gerechtigkeit und es wird tödlich ernst. Und Gott hat jedermann den Glauben angeboten, indem er diesen Mann, dessen Namen Paulus nicht ausspricht, von den Toten auferweckt hat. Jesus Christus.
Liebe Gemeinde,
die Freude in uns, die der Glaube an den Auferstandenen schenkt ist soweit weg von der Freude über ein bisschen heile Welt bei uns.
Ich war am Donnerstag mit meinem Sohn in der Notaufnahme im Klinikum Süd. Nichts Schlimmes. Der kleine Finger bei seinem Baupraktikum durch jugendlichen Leichtsinn von einem geworfenen Backstein gequetscht. Aber als wir da so saßen vor diesen Schiebetüren, begann es mir peinlich zu werden. Aber es war heilsam für mich. Wie tapfer mein Sohn diesen Schmerz trug. Als wüsste er was kommen würde. Dass nämlich ein gleichaltriger 16-jähriger an uns vorbeigeschoben wurde, schwerstverletzt von einem Motorradunfall. Als die Ärzte seinen Finger zunähten, hörte er in allem die Betroffenheit der Station, des behandelnden Chirurgen, der gleich mit der Kripo über die schweren Verletzungen reden musste, und er erzählte mir, wie besorgt und warmherzig sich alle in diesem Raum Sorgen machten, ob der Junge überleben würde. Er hat seinen Finger darüber fast vergessen. Ich war stolz auf ihn, dass er das so einordnen konnte. Der Unterschied zwischen einer lästigen Lappalie und der Lebensgefahr.
Auf Leben und Tod geht es. Deshalb juble ich euch nicht von meinen wunderbaren Spaziergängen in den Kirschblütenhängen vor.
Zwischen Paulus und den Sophisten Athens ist der Unterschied so groß wie der eines Notfallteams, die unter größtem Ernst und Einsatz sich um das Leben jedes Einzelnen bemühen und dem Zynismus eines Schauspielers, der glaubt, weil er in der Tatortserie den Pathologieprofessor spielt, wüsste er etwas von der Mühe dieser Lebensretter. Das ist der Unterschied vom Glauben und nur ungefähr Wissen.
Der Unterschied zwischen Glauben und nur Wissen zu meinen ist so groß wie die von dem Feuilletonisten, der eine Glosse schreibt und dem Pfarrer, der zu Hause sitzt und nicht weiß, was er den Eltern predigen soll, dessen Kind sich umgekommen ist. Und auch wenn er es nicht weiß, meldet er sich nicht krank, sondern geht hin, steht bei, weint innerlich mit und kommt leer und traurig nach Hause.
Die Predigt vom Gekreuzigten und den Auferstandenen ist ernst. Und jubeln werden wir erst, wenn wir hindurch sind.

Wir befinden uns in einer Pandemie, die ohne unser Bemühen und allergrößte Vorsicht, dem Mitwirken aller, ohne Probleme auch bei uns hunderttausende Tote kosten kann. Dem Virus fällt das ganz leicht. Und ich möchte nicht hören, dass das dann doch nur 2% von 80 Millionen seien … Ich vermisse bei all dem Gejammer und den Satiren von unterbeschäftigten Staatsschauspielern, von aufmerksamkeitssüchtigen Politikern, von gelangweilten Journalisten und ermüdeten Hedonisten klare Signale, dass sie um diesen Ernst der Lage wissen. Ansonsten sollen sie bitte ihren Mund halten.
Aber einige glauben. Das macht Hoffnung. Dass sind die Blumen der Gemeinde. Dionysios und Damaris, In den blauen Gewändern. Über den Tontöpfen mit Wasser, das Jesus zu Wein gemacht hat. Unter Einsatz seines Lebens.
Vor dem zweiten Weltkrieg hatte an dieser Stelle eine Glasmalerei „Lasset die Kinder zu mir kommen“ gehangen. So unbedeutend, dass nicht einmal eine Fotografie überliefert ist. Die einzige Bombe, die die Laufer Altstadt eher zufällig getroffen hat, hat dieses Fenster zerstört. Aber eine tiefgläubige Frau aus der Gemeinde wollte es wiederhaben. Lange wurde um das Thema gerungen. Es sollte ernsthaft ausdrücken, auf welchen Glauben wir getauft werden. Auf das Sterben und Auferstehen des Jesus Christus. Wie wir zu diesem Glauben kommen. [mehr über diese Frau steht das im BLICK Juni/Juli 2021)
Zu dieser tiefen Freude. Wasser der Taufe neben dem alten Ölbaum, der sich von grün zu blau färbt. Darüber die Toten unter dem zum Grabstein gewordenen Altar. Abstrakt sind die Fensterkreuze. Aber die Kreuze in den Gesichtern der Hörenden. Diese sind wichtiger als das verordnete Kreuz in einem Amt.
Dionysios und Damaris. Die ersten namentlich genannten aus Athen. Aus einem Saulus wurde einmal Paulus, und nun diese zwei. Aus den Glaubenden der ganzen Welt, die sich miteinander verbinden, entsteht eine große Kraft zum Leben.
Das ganze Bild. Jesus wird in ihrem Haus sein. „Jesus in my House“, singen jetzt gleich die Mädchen Lina und Magdalena. Von dem Areopag in ein einfaches Wohnhaus. Die Sklaven werden befreit. Männer und Frauen sind gleichgestellt von dem einen Gott. Der alte baum treibt neue Blätter und Früchte aus. Der Gott Israels führt in die Freiheit. Darüber sollt ihr singen und jubeln. Darüber freuen wir uns. In allem Elend. In aller Not. Das ist das Neue, weswegen Paulus unterwegs ist. Diese Botschaft geht weiter. Immer weiter. Auch wenn manche es schon uralt und altmodisch finden in ihrer Sucht nach dem immer Neuen. Einer nach dem anderen wird erfasst, gerettet und hilft mit.
Das macht Jesus – in meinem Haus und in mir.
Und der Friede Gottes, der größer ist als unser Meinen und Verstehen, erfülle euch in dem Geist Jesu!
AMEN
Literatur: Wolfgang Feneberg: Paulus der Weltbürger; Ton Veerkamp, Die Welt ist anders
*Zuschrift von Dr. Sandermann: “Die grillwütigen Epikureer sind aber etwas schlecht weggekommen. Schon Epikur musste sich Zeit seines Lebens gegen die von seinen Widersachern gestreuten Gerüchte zur Wehr setzen: ‘Wenn ich nun erkläre, dass die Freude das Ziel des Lebens ist, dann meine ich damit nicht die Lüste der Schlemmer, noch die Lüste, die im Genießen selbst liegen, wie gewisse Leue glauben, die meine Lehre nicht verstehen, sie ablehnen oder böswillig auslegen. Ich verstehe unter Freude: keine körperlichen Schmerzen leiden und in der Seele Frieden haben’ (Epikur, Brief an Menoikeus). In den “kyriai doxai” heißt es in Nr. 5: ‘Man kann nicht in Freude leben, ohne mit Vernunft, anständig und gerecht zu leben; man kann aber auch nicht vernunftvoll, anständig und gerecht leben, ohne in Freude zu leben. Wem aber die Voraussetzungen zu einem vernunftvollen, anständigen, gerechten Leben fehlen, der kann auch nicht in Freude leben’. ” Vielen Dank für den Hinweis!
2. Fastenpredigt von Lara Mührenberg. “Was bleibt von mir?” – ab Samstag 27.2. 18:30 Uhr

Erleben Sie die junge Theologin und christliche Archäologin Lara Mührenberg, wie sie sich angesichts der ersten Grabstätten der Christen Gedanken macht, was von uns bleibt. Unorthodox und frisch. Da wir zur Zeit wegen des Lockdowns keine Präsenzgottesdienste durchführen, hat Lara Mührenberg diese Predigt für uns aufgenommen. Wir haben passende Lieder und Texte dazugefügt. Ein Tip: In einem Video Lara Mührenberg zeigt uns die Katakomben in einfacher Sprache auch für Kinder.
Mit Musik von Gesang und Klavier: Miriam Eryazici “Nähme ich Flügel der Morgenröte” Gesang Tobias Link, Klavier Silke Kupper, Schlagzeug Jasper Kupper, Gitarre Joachim Rügamer Instrumentalgitarre: Gabriel Hoffmann Schnitt und Auswahl: Pfarrer Jan-Peter Hanstein
Und so geht es weiter mit unserer Themenreihe “Was bleibt.” Webinare, Predigten und digitale Ausstellung
Predigt: Erste Fastenpredigt ” Was bleibt.” mit Dr. Edmund Sandermann, 21.2.2021, Koh 3

Was bleibt?
„Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit:
2geboren werden und sterben,
einpflanzen und ausreißen,
3töten und Leben retten,
niederreißen und aufbauen,
4weinen und lachen,
wehklagen und tanzen,
5Steine werfen und Steine aufsammeln,
sich umarmen
und sich aus der Umarmung lösen,
6finden und verlieren,
aufbewahren und wegwerfen,
7zerreißen und zusammennähen,
schweigen und reden.
8Das Lieben hat seine Zeit
und auch das Hassen,
der Krieg und der Frieden.“
Prediger 3, Verse 1 – 9
Beendet wird diese Aufzählung im Buch (Kohelet), Kapitel 3, Verse 1 – 9, hier zitiert nach der Bibelübersetzung „Die Gute Nachricht“, mit der Frage:
„9Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit?“
Die Frage, die der Autor dieses Mitte des 3. vorchristlichen Jahrhunderts entstandenen Textes, der sich selbst Kohelet nennt (übersetzt etwa „der Sammler“) und behauptet ein König der Israeliten gewesen zu sein, hier stellt, ist die Frage der heutigen Fastenpredigt: „Was bleibt?“
Es ist eine Menschheitsfrage, die Kohelet hier aufwirft, eine Frage, die die Menschen seit Jahrtausenden bewegt.
Vor der eingangs zitierten Textstelle berichtet Kohelet davon, dass er seine Möglichkeiten als König voll ausgelebt habe; er habe umfangreiche Besitztümer erworben, Sklaven gekauft und sich einen Harem zugelegt habe, um Freude und Glück zu erfahren. Auch habe er nach Bildung und Wissen gestrebt, um sich in der Welt besser zurecht zu finden. Letztlich sei aber immer eine Frage unbeantwortet geblieben: „Was bleibt davon?“ Und Kohelet gibt selbst die Antwort: „Ein Windhauch“.
Unsere Lebenserfahrung ist, dass alles wird und – irgendwann – wieder vergeht. Alles hat seine Zeit, und die ist begrenzt.
Aber irgendetwas in uns Menschen will sich damit nicht abfinden, sehnt sich nach Beständigkeit und Bleibendem, ja nach Unendlichkeit. Aus dieser Sehnsucht heraus fragen wir: „Was bleibt?“. Es ist eine existenzielle, eine je individuelle Frage.
Die Frage „Was bleibt“ ist eine Frage, die nur vor dem Hintergrund der Zeitlichkeit und damit auch der Geschichtlichkeit des Menschen richtig verstanden werden kann. Sie setzt einen zeitlichen Horizont des Lebens voraus, ein zeitliches „Woher“, die Vergangenheit, aus der Bleibendes sich ergeben kann, ein zeitliches „Wo“, die Gegenwart, in der wir Dinge anfassen und festhalten können – so scheint es zumindest -, und ein zeitliches „Wohin“, die Zukunft, in die wir uns und die uns liebgewordenen Dinge hinüberretten wollen, in der wir uns und den Dingen Bestand geben wollen.
Es erscheint daher sinnvoll, der Ausgangsfrage unter den Gesichtspunkten: 1.„Was bleibt zurück?“, 2.„Was bleibt bestehen?“ und 3.„Was bleibt zutun und zu hoffen?“ nachzugehen.
1. „Was bleibt zurück?“ Die Frage kann in zweierlei Hinsicht verstanden werden. Zum einen als Frage nach dem, was wir von unserem bisherigen Leben zurücklassen müssen, können oder dürfen. Zum anderen als Frage nach dem, was von Vergangenem fortwirkt in unsere Gegenwart, gewissermaßen als aufbewahrter Bestand.
Zurück bleibt im ersten Sinne der gelebte Augenblick, das empfundene Erlebnis, das wir hatten, als wir es zum ersten Mal geschafft haben, allein Fahrrad zu fahren, das Gefühl beim ersten Kuss, die Umarmungen von geliebten Menschen, mit zunehmendem Alter auch unsere Lebenschancen, die ergriffenen und verpassten. Es bleiben zurück die Aktualität von Gewalterfahrungen und Missbrauch, die Frustrationen in der Pubertät, die unerfüllten Wünsche, die Versagensängste, die großen und kleinen Sünden.
An ihre Stelle treten die Erinnerungen, die guten wie die schlechten. Sie bleiben, manchmal überdeutlich, manchmal nur noch verschwommen; hin und wieder sind wir uns nicht einmal mehr sicher, ob uns diese Erinnerungen nicht trügen, ob wir etwas verdrängen oder beschönigen oder überbewerten. Aber es sind nur noch Erinnerungen. Auf das was war, können wir nicht mehr zugreifen, es gewissermaßen wieder zum Leben erwecken. Einen „Windhauch“ nennt Kohelet dies.
Ich denke, dass Kohelet hier zu kurz greift, wenn er das Vergangene, vor allem die vergangenen Freuden und das vergangene Leid, nur als „Windhauch“ bezeichnet. Unsere Geschichte, unsere Biographie, wirkt schließlich in uns fort. Sie ist ein entscheidender Teil unserer Identität.
Unsere Identität speist sich nämlich nicht nur aus unserer Körperlichkeit und unseren Namen, sondern auch und hauptsächlich aus unserer Lebensgeschichte, aus unseren Taten wie aus unseren Unterlassungen, den Möglichkeiten zur Entwicklung, die das Leben uns gab, und die wir ergriffen habe oder verstreichen ließen, ebenso wie aus allen Verwundungen und Beschwernissen, die zu ertragen waren, den körperlichen wie den seelischen. Was wir jetzt sind, ist das Ergebnis unserer Geschichten, unserer Biographien.
Wenn Menschen im höheren Lebensalter oftmals, wie wir sagen „in ihren Erinnerungen leben“, dann hat dies auch mit deren Wunsch nach Selbstvergewisserung zu tun. Es geht darum, in einer Lebensphase, in der vieles in Vergessenheit gerät. für sich zu wissen: „Wer bin ich?“.
Das was zu uns und zu unserem Leben gehört, verweist dabei immer auch auf unsere Gegenwart. Im Hier und Jetzt stehen wir auf dem Fundament unserer Lebensgeschichte. Was wir sind, sind wir geworden. Und was wir geworden sind, ist eine Mischung aus unabänderlichen Widerfahrnissen und unseren Entscheidungen, von Schicksal und Tat. Ist darauf die Frage „Was bleibt? gerichtet?
Natürlich gibt es auch materielle Güter, die uns für eine gewisse, unter Umständen längere Zeit zur Verfügung stehen. Wir fahren unser Auto für mehrere Jahre, haben vielleicht seit Jahren eine Eigentumswohnung oder ein Haus, ein Sparbuch, eine Rentenversicherung. Das bleibt, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Aber fragen wir wirklich danach, wenn wir uns die existenzielle Frage stellen: „Was bleibt?“?
Auch Beziehungen könne Jahre und Jahrzehnte bestehen, manche sogar ein Leben lang. Aber selbst da ist jedem von uns klar: auch das bleibt nicht für immer. Die Frage nach dem Bleibenden ist wohl keine Frage nach dem unabänderlich Vergänglichen.
2. „Was bleibt bestehen?“
Erst einmal kann es sich allenfalls um das handeln, was jetzt (noch) da ist. Das Vergangene ist vergangen. Bestehen bleiben kann allenfalls das, was jetzt noch „gegenwärtig“ ist. Aber was ist diese Gegenwart?
Wenn etwas besteht, dann doch wohl das, was ich sehen, hören, anfassen kann. Das Bleibende ist doch das Immer-zur-Verfügung-Stehende, und wenn es so etwas überhaupt gibt, dann doch wohl im „Hier und Jetzt“, oder?
Aber das „Hier und Jetzt“, die Gegenwart, in der wir unsere Welt und alles darin mit allen Sinnen wahrnehmen und aufnehmen können, in der wir uns entscheiden und handeln können, das Heute ist morgen schon gestern – wie ein bekanntes Sprichwort lautet.
Die Geschichtlichkeit unseres Menschseins ist „ein immer auf dem Weg sein“. „Verweile doch, Du bist so schön“, wie Goethes Faust es erbittet, ist nur ein Wunsch, ohne die Möglichkeit der Erfüllung. In ihm drückt sich die Erkenntnis aus, dass nichts festgehalten werden kann. Nichts in der Gegenwart hat existenziellen Bestand. Das mag überraschen. Aber machen wir uns Folgendes klar.
Das Hier und Jetzt, liegt nur wenige Sekunden zwischen Vergangenheit und Zukunft, wie Psychologen meinen. Der Philosoph Ernst Bloch spricht sogar vom „Dunkel des gelebten Augenblicks“.
Das „Dunkel des gelebten Augenblicks“ fügt nach Bloch das, was aus der Vergangenheit geblieben ist und das, was zu tun und zu hoffen bleibt, zusammen, ohne dass wir es in diesem Moment unmittelbar begreifen können. Erst wenn das Jetzt zur Vergangenheit gerinnt, können wir es betrachten, beurteilen und verstehen.
Das „Jetzt“ ist kein Ort für Bleibendes, es ist ein Ort für Veränderung, gewollt oder nicht, zu kurz zum Verweilen. „Panta rhei“, „alles fließt“, wie dies der griechische Philosoph Heraklit bereits vor 2.500 Jahren formuliert hat.
Gerade im Jetzt, in der Gegenwart, wo wir die größte Stabilität vermuten, weil wir Dinge anfassen und festhalten, Menschen umarmen und lieben, aber auch verletzen und töten können, ist kein Bleibendes. Sobald wir uns des Geschehenden bewusst werden, uns ihm gedanklich zuwenden, ist es schon vergangen. Die Antwort auf die Frage „Was bleibt“ finden wir daher offenbar nicht in der Gegenwart.
3. „Was wird bleiben?“
Die Frage „Was bleibt“, verweist erstaunlicherweise und gegen jede Intuition auf das Zukünftige. Sie ist nicht sinngleich mit der Frage „Was ist da?“, sondern mit der Frage „Was wird bleiben?“
Wenn wir nach vorne schauen, drängt sich zunächst das unter Umständen harte Fundament des Vergangenen in den Blick. Es ist wie es ist und kann nicht mehr rückwirkend verändert oder verschoben werden. Als „Bleibendes“ ist es aber nur für unsere künftigen Lebens- und Handlungsmöglichkeiten von Bedeutung. Ein davon absoluter Wert kommt ihm dagegen nicht zu.
Als Ausgangspunkt vorwärts in unserer Lebensgeschichte begründet es Möglichkeiten für die Zukunft. Diese Möglichkeiten beinhalten einen mehr oder weniger offenen Entwicklungshorizont, und zwar sowohl aus guten als auch aus prekären Lebensumständen. Dies ist kein billiger Trost, sondern unsere menschliche Lebenswirklichkeit.
Was geblieben ist, das ist einerseits das Konkrete „Es ist wie es ist“. Wenn ich in der Vergangenheit geschlemmt habe, bleiben die überflüssigen Pfunde und der Bauch, wenn ich Suchtmittel genossen habe und süchtig geworden bin, bin ich es möglicherweise noch jetzt. Wenn ich gestern noch schön, reich, gesund und beliebt war, bin ich es wahrscheinlich auch heute noch; ebenso, wenn ich arm, krank und einsam war. Deswegen hat Kohelet keineswegs recht, wenn er meint, dass alles Vergangene nur ein „Windhauch“, nur „Schall und Rauch“ ist. Die Vergangenheit kann ein harter Boden sein, aber sie ist eben immer auch eine Startrampe.
Andererseits ist, auch wenn das Fundament aus Verletzungen, Ängsten, Süchten und persönlicher Schuld besteht, ein Start in die Zukunft in verschiedenen Richtungen möglich. Auch im Sinne dessen, was Christen Umkehr nennen.
Ich möchte dies anhand einer Geschichte aus der Bibel verständlich machen:
Schriftgelehrte und Pharisäer brachten eine Ehebrecherin zu Jesus, damit dieser ein Urteil über sie fällen solle. Nach jüdischem Gesetz stand die Todesstrafe auf ihr Vergehen. Jesus widersprach dem Gesetz nicht, forderte aber die aufgebrachte Menge mit den Worten heraus: „Der, der unter Euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“. Daraufhin gingen bekanntermaßen alle unverrichteter Dinge davon. Nur die Frau blieb zurück mit Jesus. Mit ihrer Schuld, mit ihrer Vergangenheit, ihrem harten Fundament. Jesus sagte zu ihr: „Auch ich verurteile Dich nicht. Geh und sündige in Zukunft nicht mehr“.
Die biblische Sünderin wird höchstwahrscheinlich trotz dieses „Freispruches“ zunächst auch weiterhin mit der Verachtung und Ausgrenzung durch ihr soziales Umfeld zurechtkommen müssen. Es ist das hartes Fundament für ihr weiteres Leben. Aber was auch und vor allem bleibt, ist, dass sie die Chance hat, die Dinge neu und anders anzupacken, sich gegebenenfalls auch wieder Achtung und Anerkennung bei anderen zu verschaffen. Die Vergebung Jesu schafft einen unerwarteten Entwicklungsraum für die Frau, die nur kurze Zeit vorher sich sogar dem Ende ihres Lebens gegenübersah.
Was bleibt, ist daher eine Frage, die uns auf die Perspektive in Richtung Zukunft verweist. Das Vergangene ist als Erlebnis vergangen, aber noch immer unser Fundament. Dieses Fundament, unseren Ausgangspunkt, können wir nicht mehr rückwirkend ändern, aber wie unsere Zukunft aussehen soll, können wir beeinflussen.
Die Gegenwart ist zwar die Zeit der Veränderung, die aber in Richtung der persönlichen Zukunft geplant und entworfen sein muss.
Wahr ist allerdings, dass einige dafür noch viele Lebenschancen und eine lange Lebenserwartung zur Verfügung haben, andere dagegen nur Weniges von beidem, im Einzelfall vielleicht sogar nur noch eine kurze Zeit zu leben.
Was bleibt, ist aber in allen Fällen die existenzielle Möglichkeit, jederzeit das Leben, solange es währt, neu ausrichten, und – aus christlicher Sicht – mit und bei Gott jeden Tag einen neuen Anfang wagen zu können. Nach christlicher Überzeugung bleibt vor Gott alles, was wir aus Liebe zu ihm und unsere Mitmenschen tun, für immer bestehen. Schätze im Himmel, die wir schon hier sammeln können, sagt Jesus. Was das ist, kann in jeder Lebenslage anders aussehen.
Habe ich noch viele Lebenschancen und bin bei guter Gesundheit kann ich noch vieles tun, was als Tat bleibt. Aber auch wenn ich nur (noch) wenige Möglichkeiten habe, kann ich Dinge tun, die etwas verändern. Ein Lächeln, ein gutes Wort und Verständnis für andere als eine Ermutigung für entmutigte oder Stärkung für verängstigte Mitmenschen.
Das bleibt, fließt selbst in das Fundament der dadurch aufgebauten und veränderten Menschen, in ihre Familien, ihr soziales Umfeld, vielleicht sogar der gesamten Menschheit ein, und in deren Erinnerung an einen liebevollen Menschen, der ihnen zur Seite stand und geholfen hat.
Alles andere können wir nicht festhalten, müssen es früher oder später loslassen. Reichtum, Einfluss, Geld, Ruhm und Ehre ohnehin. Ein „Windhauch“, wie Kohelet sagt.
Ich möchte daher einen Wechsel der Blickrichtung dahin vorschlagen, die Frage „Was bleibt?“ nicht rückschauend, sondern vorwärtsblickend zu stellen und zu beantworten.
Was für uns Christen und darüber hinaus für jeden Menschen, der sich für die Botschaft Jesu öffnen kann, zu guter Letzt bleibt, ist die Perspektive Ewigkeit, nach der sich alle Menschen sehnen. Nicht in vergangenem Reichtum oder Ruhm, nicht im Hier und Jetzt, sondern in bleibender Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer und Herrn. „Was bleibt, ist das Angebot Gottes, das Angebot, das Angebot der jederzeitigen Umkehr, der Vergebung für unsere Fehltritte und das Angebot bedingungsloser Liebe.
„Was bleibt?“ – Wir werden es herausfinden, wenn wir uns mit Gott auf den Weg machen.
Was bleibt?“ – Wir werden es nur herausfinden, wenn wir uns auf den Weg machen.
Amen
anker|zellen – Bibelteilen auf ZOOM

Neue Bibel-Gruppen im Internet: Ankerzellen.de
Bibelteilen. Miteinander und von überall. Zu jeder Zeit.
Im Lockdown suchte ich nach Möglichkeiten, wie wir Christen uns über eine Videokonferenz treffen könnten. Da stieß ich auf die „Ankerzellen“. Der Begriff gefiel mir gleich.
ANKER: Ein fester Termin in der Woche ist ein Anker in der formlos dahinfließenden Zeit mit weniger Kontakt. ZELLEN: wenn es gut ist und von Gottes Geist inspiriert, werden diese Zellen wachsen und sich teilen. Entwickelt wurde dieses Konzept durch Pfarrer Jens Stangenberg von der Zellgemeinde Bremen.
anker|zellen

Das Bilden einer Ankerzelle
In einem ersten Schnupper-Treffen finden sich Interessierte zusammen. Dieses Treffen dauert in der Regel knapp eine Stunde. Zu Beginn des Treffens gibt es einführende Erklärungen. Dann durchläuft die Gruppe probeweise einen Anker-Zyklus. Am Ende ist noch Zeit für Rückfragen. Wenn es bei diesem ersten Treffen ausreichend Interesse gibt, startet in der darauffolgenden Woche die neue Ankerzelle. Für einen Start sollten es möglichst vier Personen sein. Bei dem ersten regulären Anker-Treffen orientieren wir uns dann an der 40 min Zeitbegrenzung. Gut wäre es, wenn die Teilnehmenden nach den ersten zwei bis drei Treffen entscheiden, ob sie für die nächste Zeit fest zur Ankerzelle dazugehören möchten. Stabile Ankerzellen finden einmal pro Woche statt. Die Teilnahme ist (möglichst) verbindlich und sollte nur in seltenen Fällen ausgesetzt werden. Durch das flexible Online-Format kann man von nahezu jedem x-beliebigen Ort daran teilnehmen. Man kann eine Gruppe jederzeit wieder verlassen. Schön wäre es allerdings, wenn man für eine gewisse Zeit stabil zusammenbleibt.
EINLADUNG zum Ankern: Schnuppertreffen und kurze Einführung: Dienstags | 8:00 – 8:40 Uhr mit Pfarrer Jan-Peter Hanstein.
Über lauf-evangelisch.de/ankerzellen kannst du dich auf ankerzellen.de registrierenund erhältst dann die Einladung für das Zoomtreffen. Natürlich kannst du auch in einer ganz anderen Ankerzelle starten! Pfarrer Jan-Peter Hanstein
Berg der Verklärung nach dem Bild von Raffael und zum 100. Geburtstag von kurt marti – Predigt zu Matthäus 17 Letzten Sonntag nach Epiphanias, 31. Januar 2021, Pfarrer Jan-Peter Hanstein, Lauf
1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder,
und führte sie allein auf einen hohen Berg.
2 Und er wurde verklärt vor ihnen,
und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne,
und seine Kleider wurden weiß wie das Licht.
3 Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia;
die redeten mit ihm.
4 Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus:
Herr, hier ist gut sein!
Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen,
dir eine, Mose eine und Elia eine.
5 Als er noch so redete,
siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke.
Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach:
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe;
den sollt ihr hören!
6 Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht
und fürchteten sich sehr.
7 Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach:
Steht auf und fürchtet euch nicht!
8 Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein.
9 Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach:
Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen,
bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
Gnade und Friede sei mit euch von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus AMEN.
Jetzt schneit es wieder. Gerade jetzt, als wir diesen Gottesdienst feiern, da geht die Sonne auf. Da ist so ein Moment der Klarheit, der Schönheit. Wir in Mittelfranken hatten da mehr Glück als andere. Eine schöne weiße Decke über alles, das braun gewordene Grün darunter verschwunden, eine Stille zwischen den dicken Flocken. Und dann riss es auf, Sonne über dem Weiß, das Licht vielfach reflektiert, während ich auf allen vieren den vereisten Hohenstein mit meiner Frau Tilla erklommen habe, den höchsten Punkt in unserem Nürnberger Land mit einem dramatischen Ausblick auf Berge, Wolken und Sonne. Die Kinder waren ermattet zu Hause geblieben. Gerade war die Welt so grau – „Harte Wochen“ werden uns prophezeit. Und für mich heißt es dann: raus. Kleine Höhepunkte setzen, im Tag und in der Woche. Vitamin D tanken. Allein das ist schon eine Herausforderung, wenn man so ermattet ist. Sogar Langlaufski habe ich noch ergattert. Einmal wieder Ski fahren, das war der Höhepunkt für uns.
Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs. Aber irgendwie wird alles plötzlich schwer, der Lack ist ab, sie haben die Leichtigkeit verloren. Eigentlich war es aufregend mit Jesus, die Tage waren erfüllt, Heilungen und Wunder und immer wieder starke Worte und wunderbare Gleichnisse.
Und dann sagte Jesus, dass es so nicht mehr lange weitergehen würde. Dass was auf ihn zukommt, etwas Schweres, Leiden und vielleicht der Tod. Petrus schaffte es wieder einmal, und sagte ohne Verständnis für Gottes Absichten: „Gott bewahre dich, Herr! Das widerfahre dir nur nicht!“ (Mt 16, 22). Kurze Unruhe, dann gingen sie weiter.
Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit ihm.
Aus der Vergangenheit kommen Mose und Elia in diesen Moment. Sie sind die leuchtenden Vorbilder Jesu. Sie stehen für die Weisung Gottes und für die Einsicht, die man daraus gewinnen kann. Da findet ein Gipfeltreffen der besonderen Art statt. Mose rechts mit der Tafel und Elia links. Beide Gott besonders nahe. Mose, so heißt es, wurde von Gott selbst begraben. Und niemand hat sein Grab je finden können. Und Elia ist direkt in den Himmel gefahren, entrückt worden. Sie sind spurlos zu Gott verschwunden, diese beiden. Jesus in der Mitte und sie reden ganz vertraut miteinander, als würden sie sich kennen seit unvordenklicher Zeit. Dass es auch für ihn so kommen wird. Ein leuchtender Moment, all dem Grau, aller Sorge und Angst enthoben.
Raffael Verklärung

Nach der Mona Lisa das wohl berühmteste Bild von Raffael: Verklärung. Sein letztes Bild (1518-1520)
Genauso stellen wir uns die Geschichte vor, oder?
„Hier ist gut sein“ sagt Petrus. Oder seufzt er? Einen leuchtenden Moment raus aus der grauen Gegenwart, Klarheit, Übersicht und vor allem eine Perspektive bekommen. Ich will auch auf so einen Berg. Und ich verstehe Petrus so gut, wie und warum er das sagt. „Lass uns hierbleiben“.
Aber so ein leuchtender Moment ist einfach ein Lichtblick. Kurz wie ein Blitz.
Man kann darin nicht bleiben geschweige denn wohnen. Er denkt nicht an die anderen 9 Jünger da unten. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke.
Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr.

Die Jünger -können nicht hören, nicht sehen. Zu mächtig und erschreckend.,
7 Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht!
Der Moment ist vorbei. Alles wirkt wieder wie vorher. Ganz normal dieser gar nicht so hohe Berg. Eher so ein Mittelgebirge, vielleicht der Berg Tabor mit seinem Blick auf Nazareth und den See Genezareth. So wie man vom Moritzberg von einer bestimmte Stelle aus ganz Lauf sieht und fast alle seiner Ortschaften. Da unten. Die andere Hälfte.
Zeitgleich. Vielleicht können die Jünger den Menschauflauf da unten sogar erkennen. Die Protestierenden, Die sich auflehnen gegen das Unvermeidliche. Die Hoffnung geschöpft haben und bitter enttäuscht werden.

Das sieht das so aus. Dunkel. Schwer zu erkennen.
Die entblößte kniende Frau. Schön und verzweifelt. Eine Mutter. Sie zeigt so mit dem Finger über die Schulter – dahinter der ihr Sohn, eindeutig krank, der „Mondsüchtige“ – Epilepsie sagen wir heute, damals von einem Dämon befallen, die Augen rollend, Schaum vor dem Mund, der Vater hält ihn mit großen bittenden Augen, verzweifelt.
Die Menge empört. Warum tut ihr nichts dagegen? Wo ist euer Glaube? Ganz unten ist es dunkel.
Eindeutig abgegrenzt von dem Menschenauflauf – die neun zurückgebliebenen Jünger. Ganz unten.
Sie reden, sie diskutieren, wehren ab, tuscheln, betroffen, ratlos, machtlos.
Und einer hat das ganze beschrieben. Aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht von links unten es auch gemalt, Von links unten aus der Schrift kommt das Licht! Matthäus. Er hat es aufgeschrieben. Auch diesen Moment. Wir konnten nicht tun. Wir haben versagt. Das ist die Kirche in der Pandemie. Zerstritten. Ohnmächtig. Aber immerhin sind sie zusammen.

14 Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, kniete vor ihm nieder 15 und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn! Denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden; er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser; 16 und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen.
„Sie konnten nicht helfen!“
Einer der Jünger zeigt nach oben. Ohne ihn können wir es nicht tun.

Und so sieht das ganze Bild aus. Einzigartig in der Zusammenstellung der Gleichzeitigkeit, wie es Mt erzählt hat. Niemand hat so jemals zuvor gemalt. Höchster Klarheit, der Himmel öffnet sich, die Heiligen reden miteinander, die Stimme Gottes erschallt wie bei der Taufe: „siehe, das ist mein Sohn an dem ich wohl gefallen habe“ Und das bringt Raffael zusammen mit dieser bräunlichen Erde, mit diesem verfaulten Gras, mit diesen schrecklichen besessenen zuckenden Jungen- niemand hat zuvor so die ohnmächtige Kirche gemalt, die Macht Gottes und dieie Verzweiflung der Menschen.
Der leichte Moment. Da oben. Die Schwere und das Dunkle da unten. Der Berg sieht jetzt aus wie ein Opferaltar. Und mir wird klar:
Oben ist zwar nicht unten, aber es nicht getrennt. Da oben wird gerungen. Gebetet. Geglaubt. Da wird hinaufgetragen all das Elend, all das Leid. Das andere verschwindet nicht einfach. Deshalb beten wir am Altar. Beleuchten ihn mit Kerzen. Es gehört zusammen. Nicht die da oben und wir da unten – „Das ist mein lieber Sohn“. Oben der Schwebende und unten der Besessene.
Verklärung? Wird hier etwas geschönt? Im griech Text steht metamorphein. Verwandlung. In die Herrlichkeit. In das Licht.
Heute wäre der dichter und pfarrer kurt marti 100 jahre alt geworden.
Er war Schweizer, deshalb der Schnee auf den Bergen. Und den „berg der Verklärung“ hat er so verdichtet.

berg der verklärung
schnee
seiner herrlichkeit
schnee
seines lichts
blenden im glanze
des innern gesichts
spurlos nahen
moses elia
und glühen
verglühen
ins nichts
schnee
seiner herrlichkeit
schnee
seines lichts –
doch er mahnt
zum abstieg
ins tal der kämpfe
und des verzichts
Liebe Gemeinde, stellt euch vor, es wäre so gewesen wie bei Mose oder bei Elia – jetzt wäre das Evangelium zu Ende gewesen! Ein perfekter Moment – Jesus schon schwebend in der Luft, noch einen kurzen Moment und er wäre hinauf getragen worden zu Gott. Reicht es nicht, was er den Menschen bis dahin gegeben hat? Übrig bleiben würden wunderbaren Geschichten, Die Gleichnisse vom verlorenen Sohn, von der Barmherzigkeit, seiner Bergpredigt – würde das nicht schon genügen?
Aber nein – Jesus geht wieder hinab, hinunter. „ins tal der kämpfe und des verzichts“.
Versteht ihr? Die ganze Verklärung, die ganze Macht des Glaubens hätte keinen Sinn, wenn er nicht wieder hinunter gehen würde. Wenn er sich nicht hineinbegeben würde in unser Schicksal. Miteinander gehen wir jetzt in die Passionszeit. Den Weg des Sterbens, des Leidens, der Dunkelheit mit Furcht und Zittern. Durch die Pandemie. Aber nicht ohne Hoffnung. Dafür ist dieser Ausblick da. Dier Lichtblick. Da ist Jesus und als er wieder unten ist bei dem Knaben –
17 Jesus aber antwortete dem Vater und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her! 18 Und Jesus bedrohte ihn; und der Dämon fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde.
Verklärung, Verwandlung in Licht.
Wisst ihr wie eine alte Glühlampe Licht bringt?
Da ist Energie, der Strom, unsichtbar, aber fühlbar. Der Glaube. Aber Licht entsteht nicht in den reinen Kupferkabeln, sondern dort im Glaskolben, in diesem winderständigen „verschmutzten“ Legierung aus Wolfram und anderen Stoffen. Ist er zu schwach, dann wird der Glühdraht nur warm, ist er zu stark, dann brennt er durch. Aber richtig dosiert strahlt das Licht auf.
Wenn es Widerstände, wo sich menschlich und göttlich untrennbar vermischt, und es heiß wird, genau da strahlt der Glaube auf. Das sehen wir an diesem Jesus auf dem Berg. Deshalb ist er so stark im Leid, mit den Kranken, Mit den Eltern und ihren Sorgenkindern.
Wir steigen also mit ihm herab. Christus ist das Licht. Singen wir dann an Ostern.
Wie und wo auch immer.
Noch ein letzte mal kurt marti –
der tröster
der tröster
träte doch aus seinem dunkel
der tröster hinaus ins licht!
nicht bräuchte sein kommen
sein antlitz sichtbar zu werden
ein hauch der berührte
ein wahrhaftiger tonfall genügte uns:
die – von falschen tröstern genarrt
– aller tröstung misstrauen uns:
die – trostlos lebend und sterbend –
einander nicht zu trösten vermögen
aus: Kurt Marti – gott gerneklein. gedichte
AMEN
Das Gedicht „berg der verklärung“ stammt aus: Kurt Marti, geduld und revolte. Die gedichte am rand (Neuausgabe) Stuttgart 2002, Seite 41.
Gebet zum Glockengeläut

Auch wenn wir uns derzeit nicht treffen dürfen: im Gebet zum Glockengeläut (mittags oder irgendwann am Tag) sind wir mit Gott und auch untereinander eng verbunden.
Kommen wir gemeinsam vor Gott.
Hören auf die Glocken
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
– Amen.
Mein Herz ist bereit – Gott. Mein Herz ist bereit.
aus Psalm 57
Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Großer Gott,
du bist in Jesus Christus zu uns gekommen.
Jetzt kommen wir zu dir.
Du bist nah, nur „ein Gebet weit entfernt“.
Lass uns ganz da sein vor Dir.
Danke, dass wir uns an Dich wenden dürfen
so wie wir sind.
Mit allem, was uns in diesen Tagen bewegt.
Herr, erbarme dich!
Stille
In Gedanken spüren wir unserem Tag nach:
- Was habe ich heute gemacht?
Was werde ich heute tun?
Was habe ich verfehlt? - Was bewegt mich gerade besonders?
- Um wen sorge ich mich?
- Wofür bin ich dankbar?
Mit all unserem Tun und Lassen sind wir vor Dir.
Mit all unseren Gedanken und Sorgen.
Mit all unserer Dankbarkeit und unserem Lob.
Bitte um Vergebung
Wir bitten Dich, Gott:
Nimm von uns, was uns belastet und bedrückt.
Nimm von uns, was uns von uns selbst und von anderen trennt.
Nimm von uns, was uns von Dir trennt.
Herr, erbarme dich!
Fürbitten
All eure Sorgen werft auf Gott,
1. Petrus 5,7
denn ER sorgt für euch!
Sei uns und unseren Lieben nahe in dieser Zeit,
schenke uns Freude am Leben und deinen Schutz.
Sei nahe allen Kranken und allen Einsamen.
Besonders denen in Heimen, Kliniken und zu Hause,
die keine Besuche mehr bekommen dürfen.
Besuche Du sie
und gib uns den Mut, andere Wege zu Ihnen zu finden.
Sei nahe allen Kindern und Jugendlichen,
die gerade nicht in die Schule gehen
und sich nicht mit Freunden treffen dürfen.
Behalte Ihnen ihre Lebensfreude in dieser Zeit.
Sei nahe allen in Sorge und Angst,
gerade auch denen, deren Existenz bedroht ist.
Schenke deine Zuversicht
und zeige Wege auf, die weiter führen.
Schütze und ermutige alle Bediensteten
in Medizin, Rettungsdiensten und Polizei,
aber auch in Supermärkten, Apotheken und bei der Post,
– alle, die in dieser Krise Stabilität geben.
Gib Weisheit denen, die Verantwortung tragen,
und lindere die sozialen Folgen weltweit.
Ganz besonders auch die Folgen für die Menschen,
die zu allem noch im Krieg leben
oder auf der Flucht sind.
Lass deine Welt eine lebenswerte Welt sein.
Hilf auch uns gerade jetzt Ruhe zu bewahren,
Glauben an dich zu stärken, einander zu helfen
und zu umbeten.
Wir vertrauen Menschen und Anliegen,
die uns besonders am Herzen liegen,
Gott an.
Herr, erbarme dich!
Dank und Anbetung
Fürwahr, er trug unsre Krankheit
Jesaja 53,4
und lud auf sich unsre Schmerzen.
Danke Gott, dass Du unsere Bitten hörst
und in deine Hand nimmst.
Danke Jesus, dass Du Krankheit und Schmerzen trägst,
dass Du mit uns und für uns gelitten hast.
In dunkler Zeit bist Du unser Licht.
Im Schwanken Du unser Halt.
In Angst Du unsere Geborgenheit.
Danke dafür.
Danke aber auch,
dass wir gerade manches Neue erleben,
was unseren Blick verändert.
Danke, dass wir jetzt, wo manches bedroht ist,
erkennen, wir reich du uns beschenkst:
Wir danken dir für unser Leben
und relative Gesundheit,
für Kontakte mit geliebten Menschen,
für grundsätzliche Versammlungsfreiheit
und unsere Gottesdienste.
Danke für die Zeit und Ruhe,
die viele von uns plötzlich haben.
Danke für das Wachsen und Grünen
und den Gesang der Vögel unterm Himmel.
Nicht Corona soll diese Welt beherrschen, sondern Du.
Lass uns Dir gehören, hier und ewig bei dir!
Alles Menschliche, auch alle Krisen vergehen einmal – aber Deine Liebe bleibt!
Lob sei Dir, in und trotz allem!
Vater Unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name!
Dein Reich komme!
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden!
Unser tägliches Brot gib uns heute!
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern!
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen!
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Segen
So segne uns der gnädige und allmächtige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
“Fast schöner als Weihnachten“
Unter dem Motto „Wir haben den Herrn gesehen“ erlebten mehrere hundert Menschen an Ostern in der evangelischen Kirchengemeinde Lauf die ganze Bandbreite der Emotionen. Am Gründonnerstag wurde in St. Jakob der Abschied Jesu liturgisch und kulinarisch als Feierabendmahl gestaltet. Am Karfreitag in der Johanniskirche tröstete ein Trio mit Gesang, Flöte und Klavier über den Tiefpunkt der Sterbestunde hinweg. Am Ostersonntag selbst strömte die Gemeinde auf den Kunigundenberg zur Osternacht mit Osterfeuer, auf den Salvatorfriedhof zur Auferstehungsfeier mit der Johanniskantorei und in die Kirchen, wo musikalisch und fröhlich gefeiert wurde. In St. Jakob feierte Vikarin Anne Richter mit den Familien. In der voll besetzten Christuskirche hatte das C1-Team sogar ein aufwändiges Osterspiel mit Kulissen vom leeren Grab vorbereitet.
Ein Gottesdienstbesucher äußerte sich begeistert: „So bunt – fast schöner als Weihnachten!“
Jan-Peter Hanstein, Bilder von privat





Die große Verwandlung – noli me tangere
Predigt von Pfarrer Jan-Peter Hanstein am Ostersonntag 2025 zu Joh 20
– es gilt das gesprochene Wort – hier die Audio-Datei

11Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein 12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte.
Johannes 20
13Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
14Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 15 Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. 16Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister!
17Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.
18Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe.
Liebe Gemeinde,
Der Frühlingsmorgen liegt über unserer Stadt wie ein sanfter Schleier. Die Osterglocken wiegen sich im leichten Wind, die Kirschblüten und die Kirchenglocken haben uns aus unseren Häusern gerufen. Manche waren auf den Friedhöfen, unseren kleinen traurigen Paradiesen.
Ganz anders muss es gewesen sein, als Maria Magdalena durch den Garten Gethsemane eilte – der Tau noch auf den Gräsern, die Vögel erwachend, und ihr Herz erschreckt. Der Tag dämmerte erst. Der grausame Tod, sie war unter dem Kreuz gewesen, alles noch blutfrisch, sie war noch nicht zum Trauern gekommen. Sie konnte nicht schlafen und hat für sich beschlossen, dass sie dann auch gleich zum Felsengrab gehen könnte. Sie ist die Erste ganz früh und dabei hat sie die Amphore mit dem teuren Öl, um Jesus zu salben. Kann der der Messias, der Gesalbte sterben? Ist er es wirklich gewesen? Sie weint und sieht durch die Tränen fast nichts.
1. Die Suche, die ins Leere führt
Maria heult laut auf, nachdem das Grab leer ist. Wo haben sie ihn hingetan? Nicht einmal mehr den Leichnam lassen sie ihr!
Dann geschieht etwas Bemerkenswertes: Sie sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. So schreibt es Johannes und darin liegt ein großer Schatz, für uns alle. Die griechischen Wörter, aber auch im lateinischen, für „Wissen” und „Sehen” sind miteinander verwandt. Johannes leise Kritik am Sehen und Wissen. Maria sieht aber weiß nichts. Sie hält den Mann für einen Gärtner!
Maria erkannte Jesus erst, als sie ihren Namen HÖRT. Der Glaube kommt nicht aus dem Sehen, sondern dem Hören (Röm 10,17) … So wie eine Konfirmandin es ausdrückte: “Ich verstand nicht, was Glauben bedeutet, bis ich hörte: ‘Gott sieht dich.'” Wie Jesus sie sieht und sie anspricht – das versteht Maria, dass Jesus vor ihr steht.
2. “Rühre mich nicht an” – Die große Metamorphose
Als Maria Jesus erkennt, will sie ihn festhalten, umarmen, sich vergewissern. Jesus aber sagt zu ihr: “Rühre mich nicht an!” Es ist mehr als nur eine Geste der Zurückhaltung – es ist ein Hinweis auf die tiefgreifende Verwandlung, die gerade stattfindet. Wie soll das vor sich gehen?
Der Dichter Johann Peter Hebel hat sich vorgestellt, wie die Menschen alle das Material zurückhaben wollen, aus dem einmal ihr Körper bestanden hat: Wir müssten uns verzehnfachen und mehr. Und denkt an das ganze Wasser! Geschweige denn das ganze Essen … Heute wissen wir, dass sich die Dünndarmzellen alle 2-4 Tage erneuern, Lungenbläschen alle 8 Tage, nach sieben Jahren gibt es so gut wie keine Zelle mehr in und an unserem Körper, die sich nicht erneuert hat. nur die Herzmuskelzellen und Hirnzellen brauchen 40 Jahre. Aber ich bin schon 58 Jahre alt … Seht: die Materie, aus der wir bestehen, ist auswechselbar, ohne dass unsere Identität dabei verloren geht. Das geistige Prinzip, der Gedanke, das Gedächtnis ist mächtiger als all das, was wir jemals zu uns nehmen können.
Genau das scheint bei der Auferstehung Jesu zu geschehen. Er ist derselbe und doch ganz anders. Sein Leib durchläuft eine Metamorphose im Schnelldurchgang , er befindet sich in einem Zustand des Übergangs – “Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater” – er ist nicht mehr der irdische Jesus, den Maria kannte, aber noch nicht der vollständig verherrlichte Christus.
“Rühre mich nicht an!” Noli me tangere…
Der Philosoph Jean-Luc Nancy sieht in dieser Szene etwas noch Tiefgründigeres: Jesus sagt eigentlich “Halte mich nicht auf meinem Weg zur Auferstehung auf.” Es geht nicht um ein Berührungsverbot, sondern um eine neue Art der Beziehung. Nancy macht uns klar: Wahre Begegnung bedeutet nicht, den anderen zu besitzen oder festzuhalten. Wir müssen lernen, einander zu berühren, ohne Besitz zu ergreifen. Genau das ist es, was Jesus von Maria verlangt – eine Liebe, die frei ist von dem Wunsch, den anderen für sich zu behalten. Diese Art von Liebe ist der Grundstein für jede echte menschliche Berührung.
Das “Halte mich nicht fest” bedeutet also: Halte nicht an deinem alten Bild von mir fest. Ich muss mich vollenden in der Auffahrt zum Vater. Die Auferstehung ist kein Zurück zum Status quo, sondern der Beginn einer kosmischen Transformation, die bis heute andauert.
3. “Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater” – Ein vertrautes Gottesbild
Was Jesus hier sagt, erscheint uns selbstverständlich, war es aber nicht. Er spricht von Gott als seinem Vater. Jesus hat nicht eine völlig neue Religion gestiftet, sondern er stand tief in der Tradition Israels.
Wenn Jesus Gott als Vater anspricht, dann knüpft er an, was im jüdischen Glauben bereits angelegt war. Kritische Theologen behaupten oft, diese Anrede sei ein Zeichen dafür, dass diese Worte nicht authentisch sein könnten – zu einzigartig, zu revolutionär. Doch dieses Kriterium der Unableitbarkeit verpufft angesichts der Tradition.
Die ersten Christen haben nur zögernd ausgesprochen, dass Jesus Gott als seinen besonderen Vater beanspruchte. Aber die Anrede “euer Vater”, die Jesus in seinen Unterweisungen verwendet, gehört zu den ältesten Überlieferungsschichten. Wie unser ehemalige Stadtarchivar Glückert gerne sagt: “Das Neue ist oft nur das längst Vergessene, das wiederentdeckt wurde.”
4. “Mein Vater und euer Vater” – Die Einladung zur Gemeinschaft
Am Ende gibt Jesus Maria einen Auftrag: “Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.”
Jesus bindet Gott nicht exklusiv an sich. Er öffnet die Tür für alle.
Dies erinnert mich an eine Geschichte – ein Gleichnis – ist sie aus dem Talmud?
Ein Prinz besaß einen wunderschönen Garten mit seltenen Blumen und Früchten, den er sorgsam pflegte. Eines Tages entschloss er sich, die Tore für alle zu öffnen und verkündete: “Was mein ist, soll auch euer sein. Wie mein Vater, der König, mir diesen Garten geschenkt hat, so schenke ich euch den Zugang dazu.” Die Menschen kamen zögernd, denn sie waren es nicht gewohnt, königliche Gärten zu betreten. Doch der Prinz begrüßte jeden Einzelnen mit den Worten: “Mein Vater ist auch euer Vater, mein König auch euer König.”
Das Vaterunser bleibt ein Wir-Gebet. Jeden Sonntag beten wir es gemeinsam: “Unser Vater im Himmel.” Nicht “mein” Vater, sondern “unser” Vater. In der Johannesformel findet dies seinen vollendeten Ausdruck: “Mein Vater und euer Vater”, “mein Gott und euer Gott”.
Ein marokkanischer Mann, der Muslim war, tolerierte den Wunsch der deutschen Mutter, auch christlich zu heiraten. Damals musste ich diese kirchliche Trauung beim Dekan mit einem seelsorgerlichen Gutachten genehmigen lassen. Der damalige etwas autoritäre Dekan zu Regensburg, sagte zu mir jungen Pfarrer z.A.: “Aber sorgen Sie dafür, dass in jedem Gebet klar wird, dass Sie sich an Gott den Vater Jesus Christi wenden und nicht an Allah!” Ich war schon immer etwas frech und sagte: “Herr Dekan, ich wusste gar nicht, dass Sie Polytheist sind!” Da wurde er etwas ungehalten und ich musste ihn beruhigen. Ich erzählte ihm von dem Traugespräch – Raten Sie mal Herr Dekan, was der muslimische Ehemann jeden Abend mit seinem Sohn betet!” – “Ja was denn?” Ich: “Er sagte an diesem Gebet stimme jedes Wort. Es sei so schön. Er betet jeden Abend Das Vater Unser mit seinem Sohn.” – Da ließ es der gestrenge Herr Dekan geschehen…
Versteht ihr jetzt – was es heißt, den Garten zu öffnen?
5. Der Weg zum Thron Gottes
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schrieb aus der Gefängniszelle: “Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen.” Im Gebet sprechen wir Gott als Vater an, im Handeln behandeln wir andere als Geschwister.
Liebe Gemeinde, wenn wir heute vom Ostergottesdienst zurück in unsere Häuser gehen, wenn wir am gedeckten Tisch sitzen und Ostereier suchen, wenn wir das “Christ ist erstanden” noch im Ohr haben – dann lasst uns daran denken: Der Auferstandene hat uns zu seinen Geschwistern gemacht. Sein Vater ist unser Vater. Sein Gott ist unser Gott. Er ist beim Vater. Die Botschaft ist mehr als nur die Auferstehung, mehr als Jesus gesehen zu haben – Jesus erscheint, um seine Jünger auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Er wird zu seinem Vater in den Himmel hinaufgehen! Im Glaubensbekenntnis heißt es nach der Auferstehung:
Aufgefahren in den Himmel – Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, des Allmächtigen, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten.
Aber das ist Maria und uns heute an Ostern zu viel. Wie Maria damals vom Grab zurücklief zu den Jüngern, so lasst uns diese Botschaft hinaustragen in unser Städtchen, zu unseren Nachbarn, zu allen, die noch im Dunkeln sind. Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Und wir werden auch auferstehen!
Er wird zu seinem Vater auffahren! Und wir auch!
AMEN.
Der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
SCH-LAU Mittags-Menü
Mittagsmenü vom 22.04. – 02.05.2025
– SCH-LAU-Café – Genussvoll Gutes tun.
Dienstag bis Freitag im Gemeindehaus Christuskirche


Mehr Informationen zu SCH-LAU e.V.

Mehr Informationen zu SCH-LAU e.V.

Lobpreisgottesdienst
Sonntag, 27.04.25 I 19.00 Uhr I Christuskirche
| So, 27.4. 19-21 Uhr | Lobpreisgottesdienst | Christuskirche | |
| So, 25.5. 19-21 Uhr | Lobpreisgottesdienst | Christuskirche | |
| So, 29.6. 19-21 Uhr | Lobpreisgottesdienst | Christuskirche |
Ruhige Bandmusik lädt zur Anbetung Gottes und zur persönlichen Aussprache mit Gebet oder Segnung ein.
Herzliche Einladung und Gottes Segen!

Café St. Jakob
Dienstag, 29. April 2025 I ab 14.00 Uhr I Gemeindezentrum St. Jakob
| Di, 29.4. 14-17 Uhr | Café St. Jakob | |
| Di, 13.5. 14-17 Uhr | Café St. Jakob | |
| Di, 27.5. 14-17 Uhr | Café St. Jakob | |
| Di, 10.6. 14-17 Uhr | Café St. Jakob - findet leider heute nicht statt | |
| Di, 24.6. 14-17 Uhr | Café St. Jakob |

Café St. Jakob
Gemeindezentrum St. Jakob Breslauer Straße 21, Lauf a.d. Pegnitz
Café St. Jakob
Gemeindezentrum St. Jakob Breslauer Straße 21, Lauf a.d. Pegnitz
Café St. Jakob
Gemeindezentrum St. Jakob Breslauer Straße 21, Lauf a.d. Pegnitz
Café St. Jakob - findet leider heute nicht statt
Gemeindezentrum St. Jakob Breslauer Straße 21, Lauf a.d. Pegnitz
Café St. Jakob
Gemeindezentrum St. Jakob Breslauer Straße 21, Lauf a.d. Pegnitz
Lust auf eine Tasse Kaffee oder Tee …
… ein Stück leckeren Kuchen …
… Zeit für nette Gespräche …
… dann würden wir uns freuen, Sie als Gast im Café St. Jakob zu begrüßen. Alle 14 Tage am Dienstag bieten wir in den Räumlichkeiten des Gemeindezentrums St. Jakob Kaffee, Tee (aus fairem Handel) und frischen Kuchen zu günstigen Preisen an. Wir haben jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Lasset die Kindlein zu mir kommen
Samstag, 3.Mai | 14 – 18 Uhr | Spitalruine
175 Jahre Eckert’sche Kindergartenstiftung


Einladung
Am Samstag, 3. Mai, feiert die Eckert’sche Kindergartenstiftung ihr 175-jähriges Jubiläum mit einem gemeinsamen Kindergottesdienst in der Spitalruine.
Hierzu ergeht herzliche Einladung!
Historisches
„Noch heute trägt die Eckert’sche Stiftung einen der ältesten Kindergärten Bayerns und steht somit am Anfang einer sozialpädagogischen Entwicklung, die in Lauf bis heute zur Errichtung von 13 weiteren Kindergärten und –horten verschiedener Träger führte. Die „Kleinkinderbewahranstalt zu Lauf wurde nach der Stiftung von 800 Gulden durch die Krämerswitwe Anna Dietz 1838 ins Leben gerufen und am 14. Mai 1850 im gemieteten Hinterhaus des Anwesens Rempel, heute Friedensplatz 1 eröffnet. 1885 konnte dann ein eigenes Haus für die Kinderschule in der Glockengießerstraße 9 erworben werden, das sich jedoch bald für die zunehmende Kinderzahl wieder als zu klein erwies. 1912 bezog die Kinderschule ihr heutiges Domizil, das an der Stelle des ehemaligen Laufer Schulhofes entstand und daher auch unter dem Namen „Kindergarten alter Schulhof“ bekannt geworden ist.
Dass sich die „Laufer Kinderbewahranstalt“ stetig fortentwickelte und vor allem für die Kinder aus sozial schwächer gestellten Familien in der aufstrebenden Industriestadt segensreich wirken konnte, verdankt sie einer Reihe von sozial denkenden und handelnden Lauferinnen und Laufern, die immer wieder durch Zustiftungen die finanzielle Basis der privaten Stiftung gestärkt haben.
Hier ist vor allem der aus Lauf stammende Patrimonialrichter Friedrich Eckert in Nürnberg zu erwähnen, der 1871 eine Summe von 10.744 Gulden für die Kinderschule testamentarisch hinterließ. Dieses ansehnliche Kapital ermöglichte die Umwandlung der Einrichtung in eine Stiftung mit öffentlich rechtlichem Charakter im Jahre 1873. Laufs ältestem Kindergarten, der über viele Jahrzehnte hinweg von Neuendettelsauer Diakonissen betreut wurde, kommt auch noch heute als Haus für Kinder eine wichtige Aufgabe zu.“
Jan-Peter Hanstein
Ökumenisches Sonntagsfrühstück in St. Otto
Sonntag, 4. Mai I ab 8.30 Uhr I Pfarrzentrum St. Otto
Das kostenlose besondere Sonntagsfrühstück “Besser gemeinsam, als einsam” ist ein Angebot an ALLE, die Freude am Frühstück, an persönlichen Begegnungen, Gesprächen und Austausch mit Menschen haben. Egal ob Familien, Einzelpersonen, Menschen mit geringem Einkommen, Alleinstehende oder Alleinerziehende, Rentner usw. – ALLE sind herzlich willkommen!
Es ist ein ökumenisches Angebot der evangelischen und katholischen Kirche und findet im Katholischen Pfarrzentrum St. Otto statt. Wir freuen uns auf Sie und decken Ihnen gerne den Tisch!

Ab 8.30 Uhr ist im Kath. Pfarrzentrum St. Otto der Tisch gedeckt.
Das Sonntagsfrühstück wollen wir bei gutem Wetter im Pfarrhof stattfinden lassen. Sollte es regnen, gehen wir in unseren „gewohnten“ Pfarrsaal, stellen großzügig die Tische und halten die Türen zum Innenhof und Fenster geöffnet.
Bitte geben Sie die Information über das „Sonntagsfrühstück“ an Bedürftige in Ihrem Umfeld weiter.
Wer Interesse hat, im Team mitzuhelfen, kann sich beim Pfarramt Tel. 2201 oder bei Friedrich Utz (Tel. 988195) melden. Über neue Verstärkung freuen wir uns sehr.
An folgenden Terminen dürfen wir Sie begrüßen:
| So, 4.5. 8:30-10:30 Uhr |
| So, 1.6. 8:30-10:30 Uhr |
| So, 6.7. 8:30-10:30 Uhr |

Ökumenisches Sonntagsfrühstück
Kath. Pfarrzentrum St. Otto in Lauf, Großer Saal, Ottogasse 10, Lauf an der Pegnitz
Ökumenisches Sonntagsfrühstück
Kath. Pfarrzentrum St. Otto in Lauf, Großer Saal, Ottogasse 10, Lauf an der Pegnitz